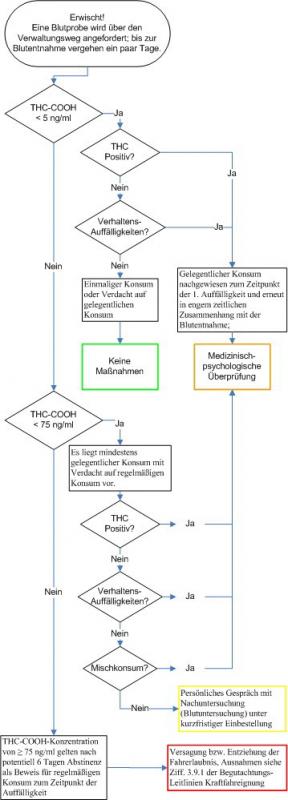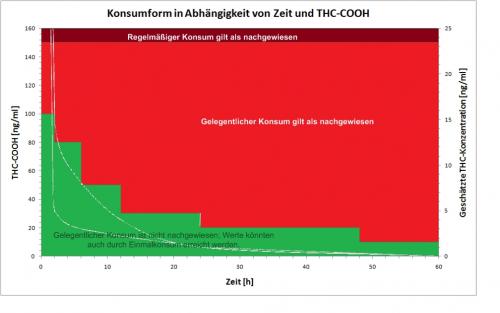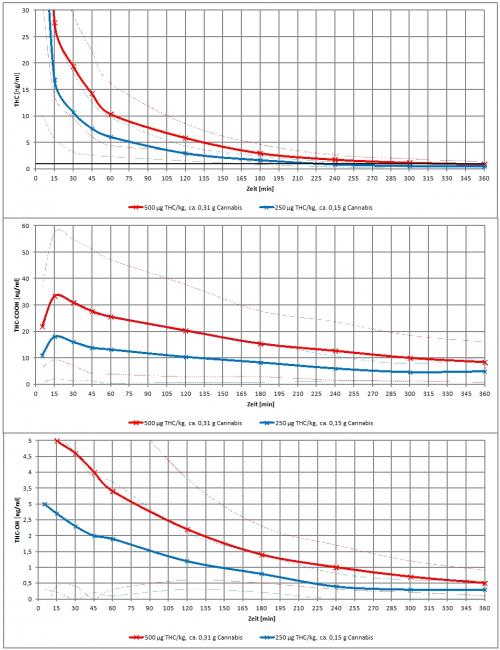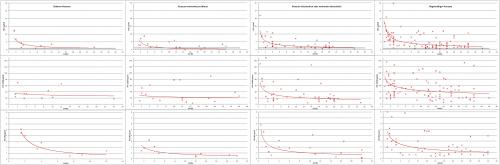Willkommen, Gast ( Anmelden | Registrierung )
  |
 21.10.2007, 11:04 21.10.2007, 11:04
Beitrag
#1
|
|||||
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
QUELLTEXT [url="http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=59714"]FAQ MPU und Rauschmittel: Rauschmittel, Wirkstoffe, Metaboliten; Versuch einer Übersicht[/url] P.S. "FAQ-Verlinkung": V.g. Code einfach markieren, kopieren und in jeweiliges Posting einfügen - fertig ist der Link :-) ________________________________________________________________________________ Drogen und Medikamente im Straßenverkehr Inhalt Einleitung Links zu weiteren, interessanten Informationen Metabolismus – Stoffumwandlungen im menschlichen Körper Cannabinoide - Δ-9-Tetrahydrocannabinol (THC) - 11-Hydroxy-Tetrahydrocannabinol (THC-OH) - THC-Carbonsäure (THC-COOH) Amphetamine - Ecstasy - Amphetamin - Methamphetamin - Ephedrin - MDA - MDMA - MDE - Methylphenidat Kokain Benzodiazepine - Benzodiazepin - Diazepam - Clorazepat - Nordiazepam - Oxazepam - Flunitrazepam Die einzelnen Artikel über die Wirkstoffe sind größtenteils untergliedert in folgende Abschnitte: Synonyme Chemische Gruppe Strukturformel und Stäbchenmodell Vorkommen/Verwendung Aufnahme Nachweis Bewertung Metabolisierung Wirkungen - Wirkungseintritt und -dauer - Symptome - Wirkungsweise - Akute Toxizität - Chronische Toxizität - Entzugserscheinungen Einleitung
Wenngleich zu den meisten Wirkstoffen und Rauschmitteln vielfältige Informationen über das Web verfügbar sind, z.B. zu den Themen:
Dieses Posting sei nun der Startpunkt für einen Thread, der den VP-Usern solche Informationen zur Verfügung stellen soll. Der Thread wird mit einer kurzen Einführung zu den Grundlagen der Reaktionskinetik beginnen, an den sich dann Dossiers zu Wirkstoffen und Rauschmittel anschließen. Wenngleich der „Anfangsbestand“ an Dossiers zunächst noch halbwegs thematisch geordnet sein wird, so werden später Artikel folgen, die erst recherchiert werden, wenn es durch die Fragestellung eines Users nötig wird. Das so entstehende Sammelsurium wird durch ein thematisch sortiertes Inhaltsverzeichnis mit Links auf das konkrete Posting handhabbar. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sachliche Fehler gepostet wurden. Eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen kann deshalb nicht gegeben werden. Die Informationen sind größtenteils im Internet frei verfügbar; sie wurden vom Autor aus Webseiten u.a. von Hochschulen, Instituten, Behörden, Verbänden und Vereinen, sowie von Unternehmen und Privatpersonen zusammengetragen und aus der Sichtweise der Chemikaliensicherheit geordnet und dargestellt. Im Gegensatz zu teilweise sehr guten Zusammenfassungen auf Konsumenten-nahen Websites geht die Diktion aber klar in die Richtung, dass jeglicher Missbrauch von Drogen und Wirkstoffen – auch im Sinne von „Safer Use“ – strikt abgelehnt wird und nicht zu diskutieren ist. Unter diesem Aspekt ist auch die Schilderung der Symptome und Wirkungen in den Wirkstoff-Dossiers zu verstehen: Es ist offensichtlich, dass sowohl die Wirkrichtung selbst, als auch deren Schwere abhängig ist von der Konsumdauer, -frequenz und –menge sowie von individuellen körperlichen oder umfeldbedingten Faktoren. In den Dossiers wird dahingehend weitgehend nicht nach *Risiko* differenziert, sondern im Sinne der Vorgehensweise bei der Chemikaliensicherheit werden die *Gefahren* des Wirkstoffkonsums im Allgemeinen beleuchtet. Analytische Grenzen und gesetzliche Grenzwerte unterliegen dem technischen Fortschritt und können deshalb nur als beispielhafte Angaben betrachtet werden, die in einem konkreten Fall durchaus völlig anders ausfallen können. Auf die Angaben von Quellen wird weitgehend u.a. aus folgenden Gründen verzichtet: Die recherchierten Informationen wurden vom Autor redaktionell überarbeitet, mit anderen Quellen verglichen und thematisch aufbereitet. Insbesondere alle Abbildungen wurden vom Autor selbst erstellt. Wurden hierzu externe Meßdaten verwendet, so wurde die Quelle beschrieben. Nahezu alle Informationen sind über das Web frei recherchierbar und stammen aus einer großen Zahl von Quellen. Fachlich anspruchsvolle Informationen bekommt man über die Verwendung von Suchmaschinen u.a. in Verbindung mit Schlüsselworten wie „Metabolismus“, „Grenzwert“, „forensisch“, „Rechtsmedizin“, „Analytik“, „Pharmakologie“ sowie unter Verwendung chemischer Identifikationsnummern. Die Verlinkung aller bei der Recherche besuchten Websites würde den Rahmen dieses Threads sprengen. Insbesondere die regelmäßige Überprüfung der Gültigkeit dieser Links wäre nicht leistbar. Einige sehr gute Zusammenfassungen sind auf Konsumenten-nahen Websites publiziert. Aus grundsätzlichen Überlegungen möchte der Autor nicht auf solche Websites verlinken. Die ausschließliche Verlinkung Konsum-ablehnender Seiten ist aber auch nicht im Sinne des Autors. Für die Diskussion bestimmter Sachverhalte, Ergänzungen und Berichtigungen des vorliegenden Threads wird ein weiterer Thread eröffnet. Der Diskussions-Thread ist hier: Diskussionen zu "Wirkstoffe, Rasuchmittel, Metaboliten" Mögen die folgenden Artikel dem einen oder anderen User eine Hilfe sein. H.H. Links zu weiteren, interessanten Informationen Infos zur "Geringen Menge" ("Eigenbedarfs-Grenze"). MPU-Beratung und Traditionelle Chinesische Medizin Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 21.10.2017, 11:26 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
||||
|
|
|||||
|
|||||
 21.10.2007, 11:11 21.10.2007, 11:11
Beitrag
#2
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Metabolismus – Stoffumwandlungen im menschlichen Körper
Im menschliche Körper laufen zahllose chemische und biochemische Reaktionen ab: Nährstoffe werden zu körpereigenen Baustoffen umgearbeitet, um Organe und Gewebe aufzubauen, Schadstoffe werden abgebaut und ausgeschieden, komplexe Regelsysteme werden über Botenstoffe realisiert, Energie wird durch Abbau energiereicher Verbindungen gewonnen. Erst durch chemische und biochemische Reaktionen können die komplexen Körperstrukturen aufgebaut werden und erst durch diese Reaktionen können Körperfunktionen ablaufen und gesteuert werden. In diesem Sinne ähnelt der menschliche Körper einer komplexen chemischen Fabrik, in der Rohstoffe angeliefert werden, die anschließend in verschiedenen mehr oder weniger spezialisierten „Betrieben“ umgebaut und verarbeitet werden, in der Stoffe in „Lägern“ auf Vorrat gespeichert werden, bis sie irgendwann benötigt werden, und in der die entstehenden Abfallstoffe irgendwann entsorgt werden. Die „Betriebe“ des Körpers sind verschiedenste Organe, und diese Betriebe haben teilweise „Maschinen“ (z.B. Enzyme), die entweder universell einsetzbar riesige Stoffgruppen mit bestimmten Merkmalen immer auf immer die gleiche Weise verarbeiten, oder die auf hochspezialisierte Weise nur Stoffe mit ganz bestimmter Form und Funktion umwandeln. „Stoffe“ – dies können bsp. Nährstoffe ( z.B. extrahiert aus Nahrung), Wirkstoffe (Medikamente oder Drogen) oder Schadstoffe sein, werden vom Körper über den Verdauungstrakt, das Atemsystem oder durch die Haut aufgenommen. Durch den Blutkreislauf können Stoffe verteilt und zu verschiedenen Organen des Körpers transportiert werden. Bestimmte Stoffe können aufgrund ihrer besonderen Form und Funktionalität in die körpereigenen Regelsysteme eingreifen, und sie können mehr oder weniger schnell selbst chemisch verändert werden. Den Prozess der Stoffumwandlung bishin zur Ausscheidung des Stoffes selbst oder seiner Abbauprodukte nennt man Metabolismus. Jegliche chemische Umwandlung eines Stoffes ändert seine molekulare Form und teilweise auch diejenigen Punkte eines Moleküls, mit denen es mit anderen Strukturen interagieren kann. Anschaulich kann man dies vergleichen mit einem Schlüssel, der in ein Schloß passen muß, um eine Tür zu öffnen: Bei modernen Schlössern reicht eine kleine Macke im Bart des Schlüssels, und das Schloß klemmt. Andererseits können alte, billige Schlösser schon mit einem Dietrich oder einem Stück gebogenen Drahtes geöffnet werden. Der Vergleich ist übrigens gar nicht so aus der Luft gegriffen: Viele biochemische Reaktionen verlaufen unter Beteiligung von Enzymen. Dies sind gewaltige Makromoleküle, die komplexe, dreidimensionale Strukturen aufbauen. Hochspezifische Umwandlungen laufen im Inneren der Enzyme ab; in vielen Fällen gelangen aber nur Reaktanden mit einer ganz spezifischen äußeren Form in das Innere der Moleküle, um dort umgewandelt werden zu können. Ähnlich verhält es sich mit den Wechselwirkungen an großen Strukturen wie Zellwänden, Membranen, etc.: Oftmals ist eine bestimmte, dreidimensionale, äußere Form notwendig, damit ein Stoff an empfindliche Rezeptoren andocken kann. In diesem Sinne verhalten sich die komplexen chemischen Reaktionen innerhalb eines biologischen Organismus nicht anders als Prozesse, die aus der Anschauung technischer Prozesse bekannt sind. Gerade die Interaktion verschiedener Moleküle und Strukturen aber ist das Prinzip, auf dem alle Regelkreise des Körpers, alle Körperfunktionen aufgebaut sind. Ein Fremdstoff, der in den Körper eingeschleust wird, kann solche Regelkreise empfindlich beeinflussen. Durch die Metabolisierung des Fremdstoffes kann aber die äußere Form und Funktionalität entscheidend geändert werden. Auf diese Weise kann sich die Wirksamkeit eines Fremdstoffes deutlich erhöhen (das „Werkzeug“ wird passend geschliffen) oder sie kann gesenkt werden (das „Werkzeug“ nutzt sich ab oder wird beschädigt). Bei der Betrachtung von Wirkung und Nachweis von Medikamenten und Drogen ist der Metabolismus von zentraler Bedeutung: Sobald ein Stoff vom Körper aufgenommen wird, beginnt der Prozess der Metabolisierung, d.h. der Stoff wird abgebaut. Dies kann durch chemische Umwandlung erfolgen, oder es erfolgt durch einfache Ausscheidung. Beide Methoden erfolgen stoffspezifisch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, und sowohl Stoff als auch Abbauprodukte wirken verschieden und werden auch verschieden in die Körperregionen verteilt. In manchen Fällen erscheinen die Ursachen-Wirkungsbeziehungen einfach (Ursache: Stoffkonzentration; Wirkung: Offensichtliche Beeinflussung der Körperfunktionen), in anderen Fällen sind die Wechselwirkungen so komplex, dass das Verständnis der Ursachen-Wirkungsbeziehungen beliebig schwierig wird. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 21.10.2007, 14:39 21.10.2007, 14:39
Beitrag
#3
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Um Einblicke in die Problematik der Metabolisierung von Wirkstoffen und Drogen zu bekommen, ist eine grundlegende Vorstellung von den Gesetzmäßigkeiten der chemischen Reaktionskinetik hilfreich. Anhand eines einfachen Modells sollen im Folgenden einige Prinzipien erläutert werden.
Die Menge eines Stoffes in einer Lösung wird durch die Größe „Konzentration“ beschrieben, die für unsere Zwecke in der Form definiert sei: Konzentration = Masse des Stoffes pro Flüssigkeitsvolumen C = m / V Wenn wir von der Messgröße „Konzentration“ sprechen, ist es für die Betrachtung eines Stoffes im Körper stets wichtig, das Medium zu definieren: Für das Medium „Blut“ gelten andere Bewertungsmaßstäbe als bsp. für das Medium „Urin“ – einfach schon deshalb, weil die Funktion dieser Medien in der „chemischen Fabrik Körper“ völlig verschieden sind: Das Blut übernimmt die Funktion des universellen Transportsystems, der Urin ist der Abfalltank der Kläranlage. Wenn wir von einem Messwert von 1 ng/ml Stoff im Blut sprechen, so bedeutet dies bei 5 Litern Blut, dass sich 5000 ng Stoff im Blutkreislauf befinden, der möglicherweise von den Nieren herausgewaschen und im Urin angereichert werden kann. Die Maßeinheit für solche Konzentrationsangaben ist für Laien etwas ungewohnt, was häufig zu falschen Vorstellungen der Mengen führt, über die gesprochen wird. Die gebräuchlichen Vorsilben sollen deshalb erläutert werden:
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie abwegig eine häufig zu hörende Argumentation ist, ein Mensch würde nur wenig Wirkstoff in seinem Fettgewebe speichern, weil er besonders schlank sei: Nehmen wir an, um einen Blutspiegel von 30 ng/ml Wirkstoff zu halten (bezogen auf THC-COOH wäre man da sicher im Bereich des gelegentlichen Cannabis-Konsums), also 30 ng/ml * 5 l Blut = 150000 ng, sei die 100fache Menge im Fettgewebe nötig; dies wären dann 300 µg * 50 = 15000 µg = 15 mg – also 15 Tausendstel Gramm. Selbst ein schlanker Mensch wird seine 5 % Fett haben, dies wären bei 60 kg Körpergewicht immerhin 3 kg Fettgewebe. In 3000 Gramm Zucker (3 Packungen aus dem Supermarkt) allerdings lassen sich 15 Tausendstel Gramm Salz bequem verstecken. Reagiert ein Stoff in einem System ab, so wird seine Konzentration in diesem System abnehmen. In erster Näherung lässt sich die Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit beschreiben durch die Beziehung: C(t) = Co * exp( -k * t ) Mit: C(t): Konzentration zum Zeitpunkt t Co : Konzentration zum Zeitpunkt null, also Ausgangskonzentration t : Vergangene Zeit k : Reaktionsgeschwindigkeit  Die Abbildung zeigt den Konzentrationsverlauf eines Stoffes mit punktueller Aufnahme zum Zeitpunkt to = 1. Obwohl die Reaktionsgeschwindigkeit in der obigen Gleichung als Konstante angenommen wird, fällt auf, dass die zu Beginn des Betrachtungszeitraumes sehr hohe Eliminationsrate mit fortschreitender Zeit kontinuierlich abnimmt: Während im Zeitraum von t = 1 bis t = 6 die Konzentration um fast 78 Einheiten abnimmt, sind es im gleichen Zeitraum von t = 20 bis t = 25 nur noch 0,26 Einheiten. Dieses Verhalten ist typisch für natürliche Abbauprozesse: Damit ein Molekül abgebaut wird, muß es einen bestimmten Zustand erreichen, es muß z.B. einen Reaktionspartner finden oder in das Wirkzentrum eines Enzyms gelangen. Aus statistischen Gründen erlangen bei einer großen Anzahl abzubauender Moleküle zu einem gegebenen Zeitpunkt mehr Moleküle den Zustand des Reaktionseintritts, als dies bei einer kleineren Menge der Fall ist. Dieses Phänomen wird anschaulich, wenn wir es in unsere Erfahrungswelt übertragen: Gegeben sei eine Hauptstraße in einer Stadt, an der immer an der gleichen Stelle und ohne Unterbrechung 10 Polizisten eine allgemeine Alkoholkontrolle bei den vorbeifahrenden Autofahrern durchführen. Als gute Beamte gehen sie dabei nach einem Standardverfahren vor, kontrollieren stets ausgeschlafen, ohne zu ermüden und mit gleicher Akribie, ohne irgendwelche Fahrer zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Ab und an ziehen sie einen alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr, und am Abend können Sie ihre Quote ermitteln. Was werden sie feststellen? Normalerweise werden sie immer mehr oder weniger die gleiche Quote erreichen – doch zu Karneval springt die Quote nach oben. Warum? Waren die Polizisten zum Rosenmontag besonders motiviert? Nein – der Anteil an alkoholisierten Fahrern war einfach nur höher und die zufällige Trefferquote ist so bei gleichem Arbeitseifer einfach nur höher. Der Einfluß der Reaktionsgeschwindigkeit k auf den Abbau wird aus der folgenden Abbildung ersichtlich: 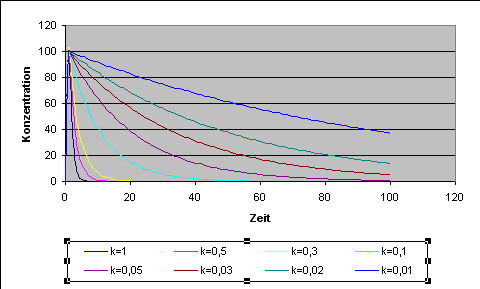 Der Verlauf der Abbaukurve wird maßgeblich durch den Parameter k Beeinflußt. Je größer die Reaktionsgeschwindigkeit, desto steiler verläuft die Kurve und desto schneller ist ein bestimmtes Konzentrations-Niveau erreicht. In der Praxis kann die Reaktionsgeschwindigkeit k von einer Vielzahl Faktoren abhängen. Einerseits beeinflussen physikalische Randbedingungen wie die Temperatur oder die Durchmischung die Reaktionsgeschwindigkeit, andererseits ist sie eine stoffspezifische Größe und wird entscheidend durch die Aktivierungsenergie einer Reaktion bestimmt ( siehe auch: Gefahrenerkennunges-Thread ). -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 22.10.2007, 19:33 22.10.2007, 19:33
Beitrag
#4
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
In der Praxis sind die Reaktionssysteme im Allgemeinen bedeutend komplexer als unsere bisherigen Betrachtungen. Die Aufnahme eines Stoffes ist weniger scharf punktuell, und insbesondere die Konzentration der Metaboliten, die ihrerseits weiterreagieren können, ist durch einen kontinuierlichen Zustrom gekennzeichnet. Deshalb erweitern wir nun unser Modell um eine solche Folgereaktion: Der Stoff A wird punktuell in einem „Vorratsbehälter“ aufgenommen (z.B. Verdauungstrakt oder Lunge), geht von dort schnell in den Blutkreislauf über, aus dem er dann durch weitere Metabolisierung langsamer eliminiert wird.
 Die Kurve für die Blutkonzentration ist typisch für den Konzentrationsverlauf nach einer Wirkstoffgabe: Je nach Resorptionsgeschwindigkeit steigt die Konzentration mehr oder weniger schnell an, durchläuft ein Maximum und sinkt dann mit dem bekannten exponentiellen Verlauf wieder ab. Häufig kann man für einen Wirkstoff eine Wirkschwelle festlegen, d.h. es gibt eine Konzentrationsschwelle, ab der eine offensichtliche Wirkung des Stoffes feststellbar ist. Sei diese Schwelle in unserem Modell bsp. 20, so kann man bestimmen, ab welchem Zeitpunkt nach der Aufnahme die Wirkung einsetzt (in unserm Modell in etwa bei t = 1,5 nach Aufnahme), wann sie ihr Maximum erreicht und wann sie so weit nachgelassen hat, bis sie nicht mehr feststellbar ist (etwa bei t = 29 nach Aufnahme). Solche Daten sind. bsp. nützlich, um zu bestimmen, ab wann und wie lange ein Schmerzmittel wirkt, aber auch, um zu wissen, wann ein Mensch aufgrund Drogeneinwirkung nicht fahrfähig ist. Ebenso wird klar: Ist die Aufnahme- und Abbaurate eines Stoffes bekannt, so kann aus zwei Messpunkten auf Zeitpunkt und Menge der Aufnahme zurückgerechnet werden. Wenngleich unsere Modellbetrachtungen die Realität nur in grober Näherung abbilden, so hat sie doch den Vorteil, dass die Tabellenkalkulation sich im Gegensatz zu einem realen Probanden nicht beschwert, wenn man ihr mehrmals hintereinander Drogen appliziert und dann über Tage hinaus alle 10 Minuten Blut abzapft. Insofern nutzen wir die Gelegenheit und dehnen unsere Betrachtungen nun auf chronischen Konsum aus: Bei gleich bleibenden Modellparametern werden nun alle 50 Zeiteinheiten erneut 100 Konzentrationseinheiten Wirkstoff zugeführt: 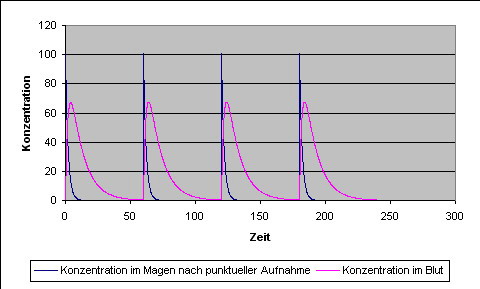 Es ergibt sich eine Art Sägezahnkurve; das Applikationsintervall ist aber noch so gewählt, dass die Wirkstoffkonzentration sich nahezu vollständig abbauen kann. verkürzt man nun die Pausen zwischen der Applikation auf ein Viertel, so ändert sich der Verlauf der Wirkstoffkonzentration im Blut markant: 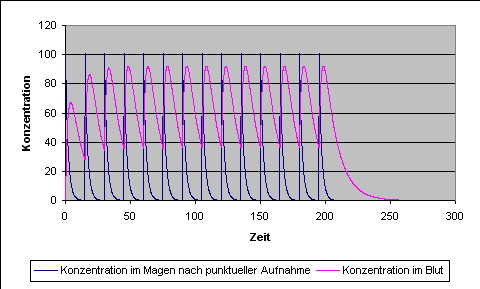 Neuer Wirkstoff wird zugeführt, noch bevor der alte Wirkstoff vollständig eliminiert werden konnte. Dies führt dazu, dass der Wirkstoff allmählich akkumuliert, bis ein Konzentrationsniveau erreicht ist, an dem die Abbaurate gleich der Zufuhrrate ist. Das Konzentrationsminimum liegt permanent über der oben angenommenen Wirkschwelle und das Konzentrationsmaximum liegt deutlich über dem Maximum des einmaligen Konsums. Letzteres führt dazu, dass auch nach begonnener Abstinenz der Zeitraum größer wird, bis die Wirk- oder auch die Nachweisgrenze wieder erreicht ist. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 23.10.2007, 20:07 23.10.2007, 20:07
Beitrag
#5
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Um eine Metabolisierung zu simulieren, die über mehrere Reaktionsstufen verläuft, kann man das Modell entsprechend erweitern. Im Folgenden werde wiederum der Stoff A punktuell aufgenommen, er wandert schnell in die Blutbahn und wird dort zu B, dieses wiederum zu C umgewandelt, der Einfachheit halber alles mit gleicher Reaktionsgeschwindigkeit:
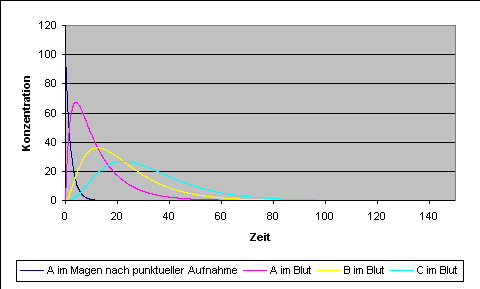 Deutlich erkennbar ist, dass die Konzentrationsverläufe flacher werden, je weiter hinten der Metabolit in der Reaktionsfolge steht. Zwar sinkt das Maximum, der Zeitpunkt, bis zu dem eine Nachweisschwelle unterschritten wird, wird aber immer weiter nach Hinten verschoben. Ursache für diesen Effekt ist die „logistische Kette“, die sich aufbaut: Jede Reaktionsstufe wird zu einer Art Speicher, der die Zufuhr von Reaktanden „streckt“. Dies führt bei chronischem Konsum zu einer beachtlichen Akkumulation der Stoffe auf allen Metabolisierungs-Stufen, was nach eintretender Abstinenz zu langen Zeiträumen mit hohen Reststoffkonzentrationen führen kann: Das Modell wird komplexer, wenn man Rückkopplungseffekte einbaut: Der Stoff A werde wieder punktuell zugeführt und mit den gleichen Geschwindigkeiten wie zuvor in den Blutkreislauf aufgenommen und dort abgebaut. Gleichzeitig aber wandere er schnell in einen Puffer (z.B. die Hirnsubstanz beim THC), der dann wiederum etwas langsamer den Stoff unverändert wieder ins Blut zurückgibt. 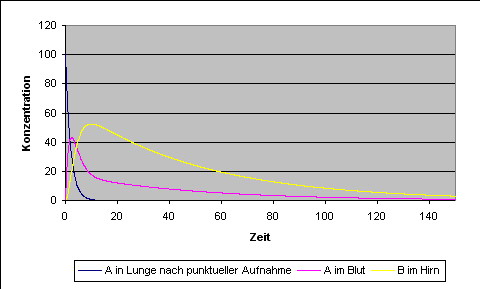 Durch den zweiten „Reaktionsweg“, die Pufferung im Gehirn, vergrößert sich anfangs die Abbaurate des Stoffes aus dem Blut. Einerseits liegt dadurch das Konzentrationsmaximum niedriger, andererseits ist die Eliminierungsgeschwindigkeit hoch. Irgendwann jedoch weist die Abbaukurve einen auffälligen „Knick“ auf: An dieser Stelle wirkt sich der Rückstrom aus dem Puffer ins Blut signifikant aus. Im folgenden fällt die Konzentration des Wirkstoffes deutlich langsamer ab, als dies bei den bisherigen Betrachtungen der feststellbar war. Dieser Effekt wir noch deutlich dramatischer bei regelmäßiger Wirkstoff-Zufuhr: 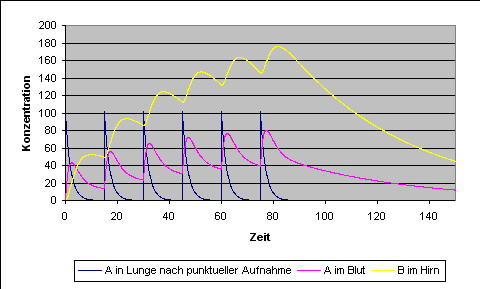 Es ist klar erkennbar, wie sich der Puffer kontinuierlich aufbaut. Durch den gebildeten Vorrat nach der regelmäßigen Zufuhr ist auch der Rückstrom aus dem Puffer in den Blutkreislauf entsprechend hoch, sodaß die eigentlich Abbaukurve des Stoffes A im Blut entsprechend flach verläuft. In der Praxis bedeutet dies, dass bei einem solchen System auch nach Abstinenz sehr lange eine hohe Wirkstoffkonzentration feststellbar ist, wohingegen nach nur einmaliger Exposition der Messwert schnell unter die Nachweisgrenze fallen kann. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 24.10.2007, 18:59 24.10.2007, 18:59
Beitrag
#6
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Versucht man mit dieser einfachen Methodik den Metabolismus des THC nachzubilden, wird selbst dieses Modell sehr komplex:
THC wird auf inhalativem Wege sehr schnell in den Blutkreislauf aufgenommen. Aus dem Blut wandert der Stoff zunächst schnell in das Gehirn, etwas langsamer zur biochemischen Umwandlung zum THC-OH in die Leber und ebenso ins Fettgewebe. Die Hirnmasse gibt aufgenommenes THC bei sinkender Konzentration wieder schnell ins Blut ab, das Fettgewebe jedoch nur sehr langsam. Ähnliche Zusammenhänge gelten entsprechend für den Primärmetaboliten THC-OH und ebenso für den Sekundärmetaboliten THC-COOH, welcher dann selbst aber kaum weiter abgebaut, sondern langsam über den Urin ausgeschieden wird. Um dieses System zu simulieren, wird ein Excel-Sheet aufgebaut, mit dem zu einem gegebenen Zeitpunkt aus den Konzentrationsdaten des vorhergehenden Zeitpunktes die Konzentrationsänderungen für die jeweilige Komponente und den jeweiligen Aufenthaltsort und damit die neuen Konzentrationen berechnet werden. Zeitintervall zwischen den „Messpunkten“ ist für die erste Stunde 0,01 h, danach 0,1 h. Für die Reaktionsgeschwindigkeiten wurden folgende Parameter gewählt: THC (Lunge) --> THC (Blut): k = 20 THC (Blut) --> THC (Hirn): k = 10 THC (Blut) --> THC (Fett): k = 2 THC (Blut) --> THC-OH (Blut): k = 1 THC (Hirn) --> THC (Blut): k = 1 THC (Fett) --> THC (Blut): k = 0,1 THC-OH (Blut) --> THC-OH (Hirn): k = 0,2 THC-OH (Blut) --> THC-OH (Fett): k = 0,2 THC-OH (Blut) --> THC-COOH(Blut): k = 2 THC-OH (Hirn) --> THC-OH (Blut): k = 2 THC-OH (Fett) --> THC-OH (Blut): k = 1 THC-COOH (Blut) --> THC-COOH (Hirn): k = 5 THC-COOH (Blut) --> THC-COOH (Fett): k = 2 THC-COOH (Blut) --> THC-COOH(Urin): k = 0,05 THC-COOH (Hirn) --> THC-COOH (Blut): k = 10 THC-COOH (Fett) --> THC-COOH (Blut): k = 0,5 Die Reaktionsgeschwindigkeiten basieren nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen, sondern wurden willkürlich so gesetzt, daß das Ergebnis der Simulation entfernt der Realität angenähert wird. Die Simulation erhebt nicht den Anspruch, die reale Metabolisierung abzubilden, sondern soll ausschließlich dem Verständnis der grundlegenden Prinzipien dienen. Für einmalige Exposition (Dosis für den Startwert und ggf. für Folgeexposition ist jeweils 100) gelangt man mit dem beschriebenen Modell zu folgenden Konzentrationsverläufen: 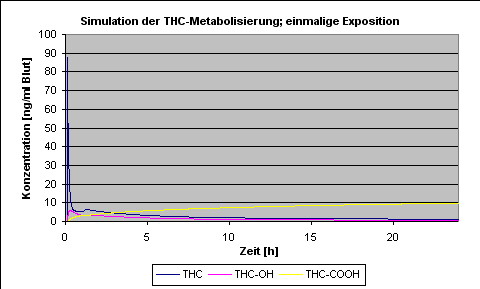 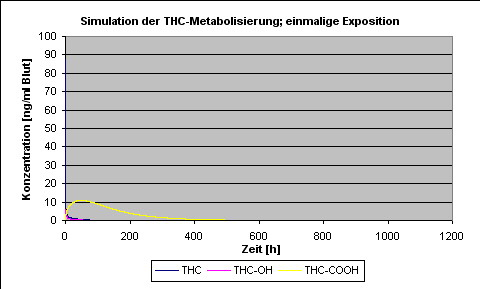 In diesem kurzen Beobachtungsintervall werden nun auch schon die Grenzen unseres einfachen Modells deutlich: Während der Konzentrationsverlauf für THC und THC-OH halbwegs der Realität nahe kommt, wird der Verlauf der THC-COOH-Kurve nicht ganz korrekt wiedergegeben: Der Konzentrationsanstieg zu Beginn ist zu flach, die folgende Abbauphase ist ebenfalls zu langsam. Ein entscheidender Faktor mag sein, dass die „applizierte Dosis“ im Vergleich zur Realität viel zu gering ist; bei einer Korrektur sind dann als Folge die Reaktionsgeschwindigkeiten und die Berechnungsintervalle anzupassen, was mit einem Excel-Sheet nicht mehr vernünftig leistbar ist. Die Verfeinerung des Modells hätte sicherlich den Aufwand einer Studienarbeit. Nichtsdestotrotz reicht das Modell, um die Unterschiede zwischen gelegentlichem und regelmäßigem Konsum zu erläutern. Halbwegs an die Realität angenähert sind die Verläufe für THC und den Primärmetaboliten THC-OH. Das THC erreicht sehr schnell sein Maximum und fällt dann auch recht schnell wieder ab. Nach ca. 20 h ist das Null-Niveau nahezu erreicht. Besondere Beachtung verdient übrigens das kleine Neben-Maximum der THC-Kurve, ca. bei t = 1: Dieses Neben-Maximum resultiert aus dem THC-Rückstrom aus der Hirnmasse zurück in den Blutkreislauf. Wenngleich ein solches Phänomen auch in der Literatur berichtet wird, überlässt der Autor es den Mathematikern, zu beurteilen, ob dieser Effekt real oder ein Artefakt der Excel-Methode ist. Die Blutkonzentration des Primärmetaboliten zeigt einen typischen Verlauf und ist im Vergleich zum THC durchweg sehr gering, weil das THC-OH zum größten Teil schnell weiter zur Carbonsäure aufoxidiert wird. Trotz der relativ geringen Konzentration liegt die Brisanz des THC-OH aber in der ca. dreifach höheren psychoaktiven Wirksamkeit. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 25.10.2007, 22:07 25.10.2007, 22:07
Beitrag
#7
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Wie ändert sich Stoffverteilung bei chronischer THC-Exposition? Die folgende Abbildung zeigt die Konzentrations-Verläufe bei THC-Zufuhr alle 96 h (4 Tage):
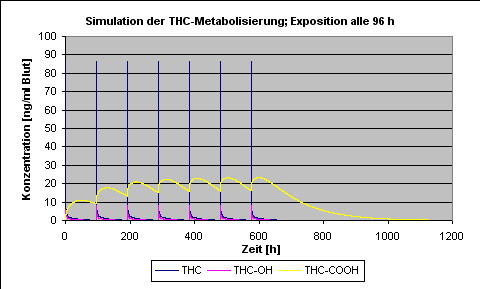 Die Kurven für THC und THC-OH verlaufen nach jeder neuen Exposition in etwa gleich. Dem System wird genug Zeit gelassen, die primären Wirkstoffe abzubauen. Die Wirkschwelle wird regelmäßig unterschritten, bevor die nächste Exposition folgt. Anders verhält es sich mit der THC-COOH-Kurve: Hier baut sich eine Pufferkapazität auf, bis die Zufuhrrate der Abfuhrrate entspricht und sich so ein dynamisches Gleichgewicht bei ca. 23 ng/ml ergibt – einer Marke im Bereich des „gelegentlichen Konsums“. Werden die Expositionspausen halbiert, ergibt sich folgendes Bild: 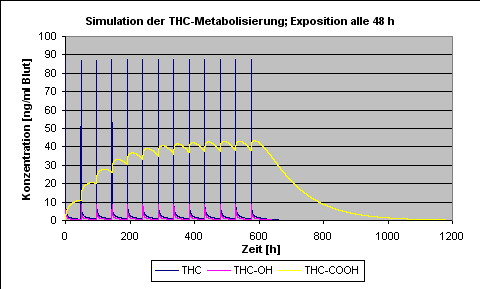 Die Primärmetaboliten können noch immer nahezu vollständig abgebaut werden. das dynamische Gleichgewicht für die Carbonsäure liegt nun schon doppelt so hoch, bei ca. 44 ng/ml, aber noch immer im Bereich des „gelegentlichen Konsums“. Werden die Expositionspausen nochmals halbiert (tägliche Zufuhr von THC), beginnt sich die Situation zu ändern: 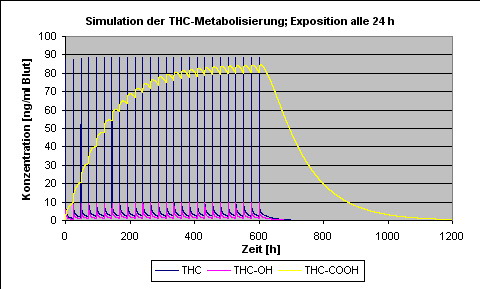 Die Expositionspausen sind nun nicht mehr lang genug, alsdaß die primären Wirkstoffe noch vollständig abgebaut werden könnten. Über die ersten 4-5 Expositionen steigt das Maximum der THC-Konzentration an und die Minima liegen deutlich erkennbar über dem Nullwert. Die Gleichgewichtskonzentration für den Langzeitmarker THC-COOH pendelt sich bei 80-85 ng/ml ein, was dem Kriterium für „regelmäßigen Konsum“ nach Daldrup entspricht. Die Situation verschärft sich ein weiteres mal, wenn die Expositionsfrequenz erneut verdoppelt wird: 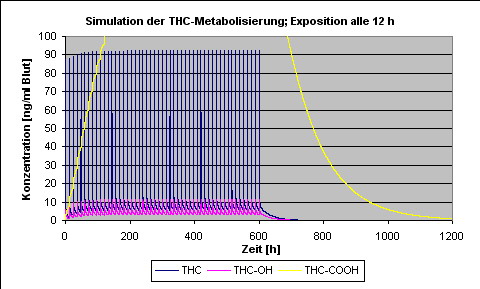 Die THC-Konzentration liegt nun permanent auf relativ hohem Niveau und auch die Konzentration des THC-OH ist erstaunlich hoch. Ein realer Proband stünde nun permanent unter Wirkstoff. Die Gleichgewichtskonzentration des Langzeitmarkers stellt sich bei knapp 170 ng/ml ein. Wenngleich die THC-Simulation „aus dem Ärmel geschüttelt“ ist und nicht auf realen Daten und seriösen Untersuchungen beruht, lassen sich dennoch folgende Prinzipien veranschaulichen:
Variiert man die Parameter für die Reaktionsgeschwindigkeiten, so kann durch chronische Exposition schon auf den Stufen des THC und THC-OH eine beachtliche Menge Wirkstoff gepuffert werden, sodaß selbst nach beginnender Abstinenz die Konzentration an THC-COOH noch steigt. Ein solcher Effekt könnte erklären, warum in manchen realen Fällen die Analysenwerte trotz Abstinenz noch erstaunlich lange sehr hoch ausfallen. In der Realität wird das Wechselwirkungssystem für die Metabolisierung des THC noch weitaus komplexer sein, als hier in diesem einfachen Modell dargestellt. Die Reaktionsgeschwindigkeiten für die einzelnen Metabolisierungs-Schritte werden vermutlich durch individuelle körperliche Faktoren beeinflusst. Immerhin sollte aber deutlich werden, wie abwegig die Hoffnung mancher Konsumenten ist, aufgrund ihres Körpergewichtes auf einen guten Stoffwechsel und einen besonders schnellen Abbau der Analyten zu schliessen. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 26.10.2007, 15:01 26.10.2007, 15:01
Beitrag
#8
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Δ-9-Tetrahydrocannabinol
CAS-Nr.: 1972-08-3 RTECS-Nr.: HP8225000 Synonyme: THC, 6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol Die Bezifferung der einzelnen Positionen geht häufig, teilweise aus historischen Gründen, teilweise aus mangelnder Kenntnis der chemischen Nomenklaturregeln, durcheinander. Für die Cannabinoide wird in diesem Artikel die nach Quadrantenregel richtige Bezifferung verwendet. Marinol Chemische Gruppe: Cannabinoide Strukturformel und Stäbchenmodell: 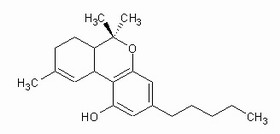 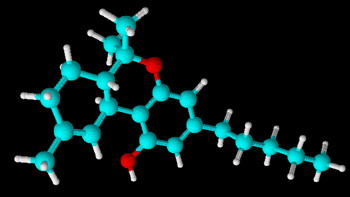 Vorkommen/Verwendung: THC ist der hauptsächliche, psychoaktive Inhaltsstoff der Cannabispflanze, wobei der Gehalt an THC sowohl von der Pflanzensorte, als auch vom Pflanzenteil abhängig ist:
Der Einsatz zu therapeutischen Zwecken ist vielfältig, wobei i.d.R. synthetisches Cannabinol verwendet wird (bsp. Nabilon, Dronabinol): Das Cannabinoid vermindert Schmerzreaktionen und wird als Betäubungsmittel eingesetzt. Begleitend zu Krebstherapien mit Cytostatika oder Bestrahlungen, oftmals auch bei HIV-infizierten Personen, findet es Verwendung als Antiemetikum, um Übelkeit und Erbrechen zu bekämpfen. Die appetitanregende Wirkung wird auch gegen Anorexie und Kachexie angewendet. THC wirkt als Antikonvulsivum bei spastischen Anfällen. Bei Glaucom-Patienten kann THC den Augendruck senken. Aufnahme: Die missbräuchliche Einnahme erfolgt überwiegend inhalativ (Rauchen; Tabak wird mit Cannabis zu einem Joint verarbeitet), mitunter aber auch oral (Beimengung in Getränken, Speisen und Gebäck). Die Einzeldosis bei inhalativer Aufnahme beträgt ca. 15 mg THC, wobei das nicht durch die Verbrennung pyrolysierte THC (20-80 %) rasch und nahezu vollständig resorbiert wird. Um die gleiche Wirkung bei oraler Aufnahme zu erzeugen wie beim Rauchen, wird ca. die dreifache Menge an THC benötigt. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik und zahlreichen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Der Nachweis von Cannabis-Konsum ist stark abhängig von Frequenz, Dosis und Dauer des Konsums sowie den individuellen körperlichen Voraussetzungen des Probanden. Insbesondere bei chronischen, schweren Konsumenten können erstaunlich lange sehr hohe Konzentrationen auch von aktivem THC in Blut und Urin nachgewiesen werden. Das unmetabolisierte THC wird normalerweise relativ schnell abgebaut und dient deshalb dem Nachweis zeitnahen Konsums. Nachweisbarkeit im Urin: 1-8 Wochen Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für THC-COOH: < 20 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Urin: 15 ng/ml Weitere Infos zu Nachweisgrenzen: Positiver Befund („berauschte Fahrt“) bei quantitativen Blutanalysen: 1 ng/ml; die analytische Nachweisgrenze liegt niedriger. Haaranalyse: Positiver Befund bei 0,02-0,20 ng/mg Haar routinemäßig möglich. Die GTFCh (2009) gibt folgende Nachweisgrenzen für forensische Erfordernisse an (die Serum/Plasma-Werte erfüllen die Vorgaben der Grenzwertkommission bzgl. § 24a (2) StVG): Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) --> 1 ng/ml (Serum/Plasma), 0,02 ng/mg (Haare) Delta-9-Tetrahydrocannabinol-9-carbonsäure (THC-COOH) --> 10 ng/ml (Serum/Plasma; bei bestimmten Fragestellungen tiefer), 10 ng/mg (Urin, nach Hydrolyse) Bei der Haaranalyse liegt die Mindestanforderung für die Nachweisgrenze für forensische Zwecke bei 0,02 ng/mg THC; meistens beträgt der Gehalt weniger als 1 ng THC, nur in Einzelfällen übersteigt der Gehalt 5 ng. THC-OH konnte bisher in Haaren nicht nachgewiesen werden (Nachweisgrenze 250 pg/mg), und THC-COOH liegt im pg- bis fg-Bereich vor. Für weitere Infos zur Haaranalyse von Cannabinoiden s. Blutalkohol 2010 Seite 1 bis 9 (Seite 38 des pdf). Praktische Erfahrungen:
Praktische Erfahrungen aus dem Board MPU und Rauschmittel: Bewertung des Konsumverhaltens: S --> Selten (etwa 1x im Monat) M --> Mehrmals im Monat O --> Oft (jedes Wochenende oder öfter) R --> Regelmäßig N --> Nicht bekannt Zeit/h | THC | THCCOOH | THCOH | Bewertung 00,5 | 22,0 | 130,0 | 5,8 | O 00,5 | 5,3 | 57,0 | | R 01,0 | 8,2 | 83,0 | 4,6 | O 01,0 | 8,0 | 18,0 | 2,0 | R 01,0 | 21,0 | 72,0 | 8,0 | R 01,0 | 71,0 | 136,0 | | R 01,5 | 6,1 | 38,0 | | R 01,5 | 11,3 | 96,0 | 4,3 | R 01,5 | 8,75 | 60,3 | 5,2 | R 01,5 | 3,0 | 11,0 | 1,4 | M 01,5 | 12,0 | 25,0 | 5,1 | S 02,0 | 2,8 | 35,7 | | M 02,0 | 6,0 | 28,0 | 3,0 | R 02,5 | 2,5 | 09,3 | 0,6 | O 03,0 | 1,2 | 57,0 | | R 03,0 | 29,8 | 150,5 | 9,2 | R 03,0 | 4,5 | 28,0 | 3,4 | R 03,0 | 8,1 | 126,0 | | R 03,0 | 5,7 | 38,9 | 2,4 | R 04.0 | 10,8 | 73,0 | 3,1 | O 04,0 | 2,5 | 35,0 | 1,0 | R 04,0 | 3,6 | 61,7 | 2,1 | M 04,5 | 2,9 | 39,0 | 0,6 | R 04,8 | 1,3 | 18,0 | 0,97 | M 06,0 | 3,7 | 49,0 | 1,8 | O 06,0 | 3,0 | 50,0 | 0,7 | R 07,5 | 1,0 | 20,0 | 0,5 | S 07,5 | 2,2 | 55,0 | 0,68 | R 08,0 | 8,0 | 100,0 | 3,0 | R 09,5 | 3,5 | 43,0 | 1,7 | R 09,5 | 11,0 | 110,0 | 4,8 | R 10,0 | 5,0 | 78,0 | | M 10,0 | 12,0 | 162,0 | 4,7 | R 10,0 | 2,7 | 46,0 | 1,9 | O 10,5 | 7,1 | 80,0 | 4,1 | O 10,5 | 9,7 | 114,0 | 4,7 | R 11,0 | 1,2 | 23,0 | 0,8 | O 12,0 | 3,6 | 66,3 | 1,4 | S 12,0 | 0,8 | 69,0 | | R 12,5 | 2,2 | 150,0 | | N 13,0 | 1,1 | 10,0 | 0,63 | R 13,0 | 1,0 | 04,9 | | O 13,5 | 1,0 | 07,9 | 0,2 | N 14,0 | 2,8 | 107,0 | | R 14,0 | 2,7 | 127,0 | | O 14,0 | 11,8 | 68,9 | | R 14,5 | 0,0 | 03,0 | 0,0 | M 15,0 | 3,3 | 59,0 | 2,1 | R 15,0 | 2,7 | 43,0 | 0,9 | R 15,0 | 7,8 | 103,3 | 1,6 | R 15,0 | 1,4 | 23,0 | 0,3 | O 15,0 | 1,0 | 18,0 | | R 16,0 | 1,0 | 09,0 | | O 16,0 | 4,9 | 83,3 | | R 16,0 | 1,6 | 26,1 | | N 16,0 | 1,3 | 15,0 | | O 16,0 | 0,6 | 06,1 | | R 17,0 | 12,0 | 304,0 | | R 18,0 | 3,1 | | | R 18,0 | 2,5 | 41,5 | 1,4 | R 18,0 | 0,7 | 09,9 | | O 18,0 | 2,1 | 34,0 | | R 18,5 | 1,6 | 20,8 | | O 19,0 | 1,8 | 16,5 | | O 20,0 | 2,5 | 42,1 | 1,3 | N 20,0 | 2,9 | 45,0 | 1,4 | R 20,0 | 8,9 | 209,2 | | R 21,0 | 2,1 | 18,4 | | O 23,0 | 1,5 | 14,0 | 0,6 | R 24,0 | 1,0 | 21,0 | | N 24,0 | 3,0 | 50,0 | | R 24,0 | 1,5 | 10,0 | | R 26,0 | 2,1 | 26,0 | | M 27,0 | 0,4 | 05,4 | | O 28,0 | 0,9 | 20,5 | | R 36,0 | 3,5 | 58,0 | 1,4 | R 36,0 | 0,7 | 08,0 | | M 38,0 | 2,06 | | | R 45,0 | 3,0 | 24,0 | 0,0 | N 72,0 | 3,4 | 46,9 | 2,1 | M 72,0 | 4,0 | 55,0 | 1,1 | O 104, | 2,4 | 15,9 | 0,4 | R 120 | 3,7 | 16,0 | 0,7 | N Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 06.05.2021, 12:09 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 27.10.2007, 17:07 27.10.2007, 17:07
Beitrag
#9
|
|||||
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Bewertung:
Gem. §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.2.1. erfüllt ein Bewerber nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er regelmäßig Cannabis einnimmt. Eine Eignung ist aber nach Punkt 9.2.2. gegeben, wenn der Konsum nur gelegentlich stattfindet und Trennung von Konsum und Fahren sowie kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, keine Störung der Persönlichkeit und kein Kontrollverlust auftritt. Cannabis ist in der Anlage I zum BtmG aufgelistet; die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann somit angeordnet werden, wenn der Betroffene Cannabis im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Ein Bezug zum Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens kann nach §11 FeV, Abs. 1 angeordnet werden, wenn gelegentliche Einnahme von Cannabis vorliegt und weitere Tatsachen Zweifel an der Eignung begründen. Nach festgestellter Nichteignung kann durch Entgiftung bzw. Entwöhnung und nachgewiesener einjähriger Abstinenz die Eignung wiederhergestellt sein. Cannabis, in Form nachgewiesenen THCs, ist ein berauschendes Mittel im Sinne der Anlage zum §24a StVG. Aufgrund des komplexen Metabolismus ist die Aufstellung einer Ursachen-Wirkungsbeziehung analog zum Alkohol problematisch. Insofern gibt es keinen Grenzwert für die Blutkonzentration an THC, ab dem die rauschmittelinduzierte Fehlerquote so hoch ist, dass eine berauschte Fahrt vorliegt, sondern es wird über den Messwert auf einen kritischen Zeitraum geschlossen, in dem eine Fahrt unter Rauschwirkung nicht ausgeschlossen werden kann. Gemäß geltender Rechtsprechung ist eine Trennung von Konsum und Führen eines Kraftfahrzeugs nicht mehr gegeben, wenn der THC-Wert über 1 ng/ml Blut liegt. Im Bereich 0,5 ng/ml bis 1,0 ng/ml THC kann der §24a dann einschlägig sein, wenn weitere Auffälligkeiten auftreten (Ausfallerscheinungen). Eine Verurteilung nach § 316 StGB ist möglich, wenn mehr als eine Auffälligkeit der Art vorliegt, daß polizeiliche Fragen oder Anordnungen nicht verstanden werden, motorische Fähigkeiten bzw. Koordination reduziert sind, die Sprache verwaschen ist, Pupillen nicht auf Licht reagieren oder das Zeitempfinden stark beeinträchtigt ist (Siehe Thread-Beitrag). Zur Bewertung der Ergebnisse einer Blutanalyse wird häufig die Tabelle nach Daldrup angeführt. Diese Tabelle enthält Konzentrationsschwellen für den Sekundärmetaboliten THC-Carbonsäure, die als Interpretationshilfe dienen sollen. Für die Bewertung einer Blutprobe ist die Berücksichtigung des Entnahmezeitpunktes von entscheidender Bedeutung: Eine Blutprobe kann bsp. bei einem konkretem Anfangsverdacht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Ereignis wie einer allgemeinen Verkehrskontrolle erfolgen. Ein solcher Anfangsverdacht kann seine Ursachen bsp. in den Anzeichen für akuten Konsum haben. In diesem Fall werden die Werte für THC und seine Metaboliten entsprechend hoch sein. In einem anderen Fall kann es sein, dass ein Konsumverdacht an die Fahrerlaubnisbehörde weitergeleitet wird, die dann wiederum die Blutuntersuchung veranlasst, um Zweifeln an der Fahreignung nachzugehen. Der Zeitraum bis zur Blutentnahme wird in diesem Fall bei mehreren Tagen liegen, d.h., Abstinenz vorausgesetzt, werden die Werte für die Kurzzeitmarker unterhalb der Nachweisgrenze gesunken sein und auch der Langzeitmarker wird sich signifikant abgebaut haben. Die Interpretationshilfe nach Daldrup wurde aufgestellt unter der Annahme, dass der Langzeitmarker THC-COOH nach ca. 6 Tagen Abstinenz bewertet werden soll. Die empfohlene Vorgehensweise entspricht dann dem folgenden Flussdiagramm: (Hinweis, 19.08.2020 H.H.: Das Diagramm dient ausschließlich zur groben Orientierung. Solch ein Schema kann die Details der Einzelfall-Behandlung nur sehr bedingt abbilden, und seit der Diagramm-Erstellung hat sich die Rechtsprechung und -anwendung auch weiterentwickelt.) Wird die Blutprobe zeitnah zum Konsum entnommen, so sind die Daldrup-Grenzen jeweils zu verdoppeln. Die Abschätzung der Konsumform aus den THC-COOH-Blutwerten bei zeitnaher Probennahme ist auch bei verdoppelten Daldrup-Grenzen schwierig: Unmittelbar nach der Aufnahme von THC, insbesondere bei intensivem Konsum, kann nicht ausgeschlossen werden, daß auch bei einmaligem Probierkonsum sehr hohe THC-COOH-Konzentrationen erreicht werden. Für eine differenziertere Betrachtung wird deshalb teilweise das folgende Schema zugrunde gelegt: Die Grenzen für die THC-COOH-Konzentrationen zur Unterscheidung zwischen gelegentlichem und Einmalkonsum werden in Abhängigkeit von der Zeitspanne seit der THC-Aufnahme angepasst. Sofern Aussagen des Probanden zu dieser Zeitspanne vorliegen, kann somit auf die Konsumform geschlossen werden. Liegen keine Aussagen des Probanden vor, so ist eine Abschätzung des Zeitraumes zwischen Konsum und Probennahme aus der THC-Konzentration möglich, wobei eine solche Aussage aufgrund der statistischen Schwankungen mit einer Unschärfe behaftet ist. Im Diagramm sind zwei Graphen für Konzentrations-Zeitabhängigkeit der THC-Werte angegeben (gestrichelte Linien, Sekundärachse), die einen Good- bzw. Worse-Case darstellen (allerdings durchaus keine Extrem-Werte; siehe hierzu auch darkstars Erhebung). --------------------------------------------- Die Cannabinoid-Konzentrationen im Blutserum werden u.A. beeinflusst durch die Zeit seit dem letzten Konsum und dem Konsum-Muster. Für einen Probanden, der kürzlich kontrolliert wurde, stellt sich häufig die Frage, welche Werte - und damit verbunden, welche behördlichen Maßnahmen - ihn wohl erwarten; ebenso stellt sich die Frage, welche Rückschlüsse aus den Werten auf das Konsum-Muster gezogen werden können. Ist ein Proband mit einem aktiven THC-Wert von mindestens 1 ng/ml angetroffen worden, so steht „mangelndes Trennvermögen“ im Raume; dies wird im Allgemeinen nur dann fahrerlaubnisrechtlich toleriert, wenn gelegentlicher (d.h. mindestens zweimaliger) oder regelmäßiger (d.h. täglicher oder nahezu täglicher) Konsum ausgeschlossen werden kann. Im Rahmen der „Maastricht-Studie“ wurden unter kontrollierten Bedingungen Probanden Cannabis-Dosen verabreicht und die Cannabinoid-Konzentrationen wurden in Abhängigkeit der Zeit bestimmt. Die untenstehenden Diagramme beruhen auf den Werten aus folgender Quelle: M. R. Möller, G. Kauert, S. Tönnes, E. Schneider, E. L. Theunissen, J. G. Ramaekers, "Leistungsverhalten und Toxikokinetik der Cannabinoide nach inhalativer Marihuanaaufnahme", Blutalkohol 43 (2006), 361. Die wichtigsten Versuchsbedingungen waren:
Durch den negativen Schnelltest soll ausgeschlossen werden, daß signifikante Depot-Effekte in die Messung eingehen. Die Probanden simulieren also quasi „Einmal-Konsum“. In den Diagrammen sind die jeweiligen Cannabinoid-Konzentrationen von THC, THC-OH und THC-COOH in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt; die angedeuteten Trendlinien bezeichnen den Verlauf der Meßwerte mit den jeweiligen Standard-Abweichungen. Im Rahmen der Aktivitäten im MPU-Board des Verkehrsportals wurden in den letzten Jahren ca. 170 Werte von auffällig gewordenen Usern gesammelt und entsprechend der Angaben zum Konsum-Verhalten und zum Zeitablauf eingeordnet. Diese Angaben entsprechen natürlich nicht Labor-Anforderungen; da die User in diesem Board anonym behandelt werden und es in ihrem eigenen Interesse liegt, freiwillig im Rahmen der Diskussion ihren Fall möglichst exakt darzustellen, wird davon ausgegangen, dass die aufgeführten Werte unter Berücksichtigung einer „Meßtoleranz“ ein gewisses Bild der Realität geben. Die einzelnen Meßwerte sind in den folgenden Diagrammen dargestellt; die Trendlinie wurde mit Excel unter Verwendung des Typs „Potenz“ erstellt. --------------------------------------------- Zur Interpretation der Analysenwerte in den verschiedenen Bundesländern wird die Lektüre des Artikels von Lexus, aktualisiert durch Uwe W, sowie der thematischen sortierten Rechtsprechung von Uwe W in der FAQ empfohlen: THC-Rechtsprechung in den Bundesländern, Versuch eines Überblicks THC-Rechtsprechung thematisch sortiert, Nach Entzugsgründen, ihren Nachweisen, Verfahrensfragen Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 19.08.2020, 16:28 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
||||
|
|
|||||
 28.10.2007, 19:10 28.10.2007, 19:10
Beitrag
#10
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Metabolisierung:
Die biochemische Metabolisierung erfolgt primär durch oxidativen Angriff an der exocyclischen Methylgruppe (C11) über das 11-Hydroxy-THC zur THC-Carbonsäure. Wenngleich der größte Teil des 11-Hydroxy-THC schnell zur stabilen und nicht psychoaktiven THC-Carbonsäure weiterreagiert, so gelangt doch eine signifikante Menge in den Blutkreislauf und wird im Körper verteilt. Die besondere Brisanz liegt dabei in der um etwa den Faktor Drei erhöhten psychoaktiven Wirkung des THC-OH im Vergleich zum THC. Die formale Zwischenstufe des Aldehyds ist offenbar bedeutungslos. Neben diesen Haupt-Stoffwechselwegen erfolgen diverse Hydroxylierungen an den exocyclischen Seitengruppen, vor allem an der langen aliphatischen Seitenkette. Der größte Anteil wird über die wasserlösliche THC-Carbonsäure über den Urin ausgeschieden. Hydroxylierte Metaboliten werden glucuronidiert und weiter metabolisiert. 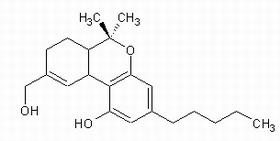 11-Hydroxy-THC 11-Hydroxy-THC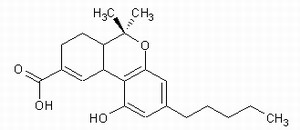 THC-Carbonsäure THC-CarbonsäureDie Toxikokinetik ist Komplex: Aufgrund der langkettigen, aliphatischen Seitengruppe und des tricyclischen Kerns sind das THC und seine Derivate sehr gut fettlöslich; darüber hinaus besitzt das Molekül eine gute Membran-Gängigkeit. Bei der Vielzahl von THC-Metaboliten und –Derivaten ist für die psychoaktive Wirkung anscheinend die Lage der Doppelbindung in 9/10-Position und die Substituierung des C1- und C9-Kohlenstoff von besonderer Bedeutung. Bei inhalativer Applikation (Joint) gelangen 20-80 % des THC schnell in die Blutbahn und werden rasch verteilt, insbesondere in gut durchblutete Organe und ins Nervensystem. Das Maximum der Blutkonzentration wird nach ca. 8-10 Minuten erreicht. Der Stoff überwindet äußerst schnell die Blut-Hirn-Schranke und wird sehr gut in der Hirnmasse gespeichert, was zu einem sehr schnellen Abfallen der Blutkonzentration führt. Ferner wird dem Blut THC entzogen, indem es in der Leber biochemisch zum 11-Hydroxy-THC und weiter zur THC-Carbonsäure umgewandelt wird. Ein weiterer Teil des THC wird aus dem Blutkreislauf entfernt, indem es ins Fettgewebe eingelagert wird. 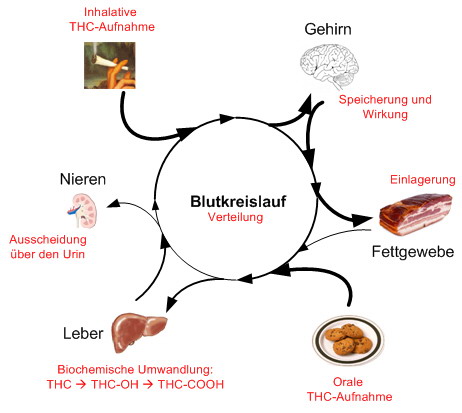 Ist die THC-Blutkonzentration hinreichend gesunken, gibt die Hirnmasse wiederum gespeichertes THC einfach in den Blutkreislauf ab; einige Untersuchungen berichten in diesem Zusammenhang von einem sekundären Konzentrationsmaximum, das durch die schnelle Freisetzung des gepufferten Wirkstoffs verursacht wird. Wenngleich das THC in der Leber schnell metabolisiert wird, so gelangen dennoch signifikante Mengen in das Fettgewebe und werden wegen der ausgezeichneten Fettlöslichkeit dort gespeichert. Im Vergleich zur Hirnmasse ist das Fettgewebe bedeutend weniger durchblutet und bietet aufgrund der Menge eine große Pufferkapazität; einmal im Fettgewebe eingelagert, wird THC (und ebenfalls seine Metaboliten) nur langsam wieder an den Blutkreislauf abgegeben. Reste von THC können mitunter, insbesondere bei chronischem Konsum, wenn der Wirkstoff akkumuliert wird, noch über Tage in Blut und Urin nachgewiesen werden. Während bei Einzelkonsum die THC-Konzentration schon nach 4-6 Stunden unter der kritischen Grenze von 0,5-1,0 ng/ml liegen kann, kann dies bei hoher Dosierung schon 12-24 h dauern; bei chronischem, schweren Missbrauch kann aktives THC auch nach 28 Tagen noch nachweisbar sein. In der Studie von Perez-Reyes, Owens und diGuiseppi (J. of Clin. Pharm. 21, 201s-207s (1981)) wurde regelmäßigen Marihuana-Rauchern nach 6 Tagen Abstinenz im Abstand von 2 h 2mal 8,82 mg THC inhalativ verabreicht. Folgende THC-Blutkonzentrationen wurden gemessen: --------------------------1. Inhalation 010 min -- > 70 ng/ml 020 min -- > 17 ng/ml 120 min -- > 03 ng/ml --------------------------2. Inhalation 130 min -- > 90 ng/ml 140 min -- > 17 ng/ml 240 min -- > 05 ng/ml Oral appliziertes THC (Haschkekse) werden über den Darm in den Blutkreislauf aufgenommen; die Aufnahmerate ist deutlich schlechter als über die Lunge. Um eine vergleichbare Wirkung zu erzeugen, muss bei oraler Aufnahme etwa die dreifache Menge an Wirkstoff eingesetzt werden. Bedingt durch den Aufnahmeweg wird der größte Teil des oral aufgenommenen THC in der Leber biochemisch umgewandelt (First-Pass-Mechanismus). Im Gegensatz zur inhalativen Aufnahme wird der Großteil der psychoaktiven Wirkung daher nicht vom THC selbst, sondern vom Primärmetaboliten 11-Hydroxy-THC verursacht. Das 11-Hydroxy-THC besitzt eine etwa um den Faktor Drei höhere psychoaktive Wirksamkeit als das THC selbst. Die Mobilität dieses Stoffes ist dabei mit der des THC vergleichbar, d.h. nach Verlassen der Leber wird der Metabolit gut Verteilt und wandert problemlos in die Hirnmasse, wo er seine Wirkung entfalten kann. Zwar ist die stationäre Konzentration des 11-Hydroxy-THC im Blut nur gering, weil es ebenfalls in der Leber schnell zur THC-Carbonsäure umgewandelt wird; durch die aufgrund der Pufferung über eine gewisse Zeit gestreckte Zufuhr an THC wird aber kontinuierlich und zeitversetzt Hydroxy-THC nachgebildet, sodaß über einen längeren Zeitraum der hochaktive Wirkstoff auf einem gewissen Spiegel gehalten wird. Wenngleich also die Wirkstoff-Konzentration im Blut anfangs sehr schnell sinkt, bleibt sie in einer zweiten Phase auf niedrigem Niveau über längere Zeit erhalten. Dieses „niedrige“ Niveau kann durch die Akkumulation aufgrund regelmäßigen Konsums Wirkungs-signifikant angehoben werden. Der Sekundärmetabolit THC-Carbonsäure schließlich ist nicht mehr psychoaktiv. Die weitere biochemische Umwandlung dieses Stoffes erfolgt nur langsam, sodaß dessen Metaboliten forensisch kaum noch interessant sind. Einerseits wird durch die Carbonsäuregruppe die Wasserlöslichkeit des Cannabinoids nun so stark erhöht dass der Stoff gut über den Urin ausgeschieden werden kann; er behält andererseits aber auch seine ausgezeichnete Fettlöslichkeit. Weil die Carbonsäure in der Leber kaum noch abreagiert, wird praktisch der größte Teil des aufgenommenen THC in Form von THC-COOH wieder in den Blutkeislauf gegeben und im Körper verteilt. Durch die Fettlöslichkeit wandert die Carbonsäure in das Fettgewebe und wird dort relativ dauerhaft eingelagert und gut akkumuliert. Dadurch wird die Carbonsäure zu einem ausgezeichneten Langzeitmarker für THC-Konsum. Bei chronischem Konsum kann sich die THC-Carbonsäure massiv anreichern und ist über viele Wochen bishin zu mehreren Monaten bei schwerem Missbrauch nachweisbar. 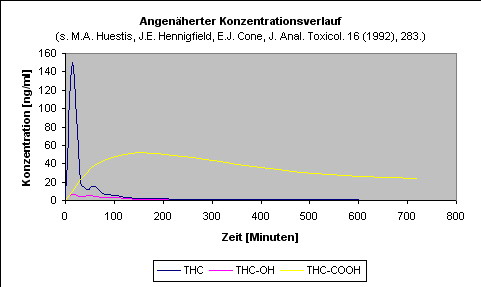 Die Abbildung ist erstellt auf Basis abgelesener Werte aus Diagrammen von Sekundärliteratur, die sich auf die Huestis-Studie bezieht. In der Studie wurden die Konzentrationsverläufe aus den durchschnittlichen Werten von 6 Probanden nach Rauchen eines 34 mg THC Joints ermittelt. Aufgrund der besonderen Pharmakokinetik des THCs und seiner Metaboliten, durch die Ansammlung an der Wirkstelle und die Metabolisierung zu wirksameren Stoffen nimmt die psychoaktive Wirkung nach THC-Konsum einen ganz anderen Verlauf, als auf den ersten Blick durch den schnellen Abbau der Konzentrationsspitzen dieser Stoffe im Blut erwartet wird. Im Gegensatz bsp. zum Alkohol ist deshalb eine Korrelation der THC-Blutkonzentration mit der psychoaktiven Wirkung nicht sinnvoll: Es besteht keine Wirkungs-Repräsentation durch die Blutkonzentration. Die Festlegung einer Grenzkonzentration für die Wirkstoffe im Blut, ab der ein akuter Rauschzustand vorliegt, ist deshalb nicht möglich. Um Kriterien für einen solchen Rauschzustand festzulegen, sind deshalb zwei Faktoren in Erwägung zu ziehen: Einerseits ist die Zeit seit dem letzten Konsum entscheidend, in der davon ausgegangen werden kann, dass die Wirkung der psychoakiven Stoffe noch vorhanden ist. Aufgrund der untersuchten Abbauraten ist hierfür der Kurzzeitmarker der THC-Blutkonzentration verwendbar. Nach geltender Meinung liegt der THC-Konsum erst dann weit genug zurück, dass eine berauschende Wirkung ausgeschlossen werden kann, wenn die Blutkonzentration bereits unter den Wert von 1 ng/ml Blut abgesunken ist. Andererseits ist zu klären, ob die Konsumfrequenz so groß ist, dass sich ein Wirkstoffpuffer aufgebaut hat, der für eine kontinuierliche Beeinträchtigung der Wahrnehmung und der Körperfunktionen spricht. Ein Maß für die Konsumfrequenz ist dabei der aufgebaute Langzeitpuffer an THC-Carbonsäure. Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 27.05.2010, 16:26 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 29.10.2007, 20:58 29.10.2007, 20:58
Beitrag
#11
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Wirkungen:
Wirkungseintritt und -dauer: Die Wirkung der psychoaktiven Cannabinoide hängt dem Blutspiegel allgemein etwas hinterher. Bei inhalativer Aufnahme setzt die Wirkung innerhalb weniger Minuten ein. Das Maximum der Blutspiegel-Konzentration wird nach 10 bis 15 Minuten erreicht; in dieser Zeit sind schon verhaltenswirksame Effekte beobachtbar, wobei das Wirkmaximum nach 15 bis 20 Minuten erreicht wird. Die subjektive Rauschwirkung klingt häufig nach 1-2 Stunden, manchmal nach 4 Stunden ab, kann in seltenen Fällen aber auch bis zu 12 Stunden andauern. Bei oraler Applikation wird das THC unvollständiger resorbiert, sodaß üblicherweise im Rahmen der subjektiven Schwankungen die zwei- bis dreifache Menge an THC im Vergleich zur Inhalation eingesetzt werden muß, um eine vergleichbare Rauschwirkung zu erreichen. Die Resorption erfolgt langsamer, sodaß einerseits die Wirkung später einsetzt (Rauschmaximum 2-3 Stunden nach Verzehr), dafür aber auch länger anhält (3-5 Stunden, gelegentlich länger). Symptome und Auswirkungen: Konjunktivitis (gerötete Augen und Bindehäute) und glasiges Aussehen der Augen. Leichte Pupillen-Erweiterung und verlangsamte Pupillen-Licht-Reaktion auf Beleuchtung (Mydriasis). Mundtrockenheit (daraus folgend Drang zum Häufigen Trinken), Schwindel, Gangunsicherheit, Übelkeit, je nach individueller Wirkungsweise auch Heißhunger („Fress-Flash“ ca. 3 h nach dem Cannabis-Konsum), Unruhe, Anstieg des Blutdrucks und der Herzfrequenz (bis 160 Schläge/Minute), sinkende Körpertemperatur. Verringertes Schmerzempfinden. Je nach individueller Wirkungsweise und Stadium Entspannung und Abrücken von den Problemen des Alltags, bishin zu Müdigkeit, Passivität, Apathie, Gleichgültigkeit und Abwendung von der Umwelt; gelegentliche und atypische Zustände von Desorientierung, Verwirrtheit, Angst, Panik und Wahn; andererseits aber auch stimmungshebende Wirkung, Glücksgefühl. motivlose Heiterkeit, Assoziationsreichtum mit Rede- und Lachdrang, Euphorie und Enthemmung. Störung der akustischen und der Farbwahrnehmung („leuchtende Farben“, Lichtempfindlichkeit, Geräusch- und Musikempfindlichkeit) Störungen des Zeitgefühls, des Denkvermögens und des Kurzzeitgedächtnisses. Verlängerung der Reaktions- und Entscheidungszeit, verschlechtertes Erkennen von zentralen und peripheren Lichtsignalen und von Details in bewegten Objekten, Verschlechterung der dynamischen Sehschärfe für bewegte Objekte sowie Verschlechterung des räumlichen Sehens; Störungen der Bewegungskoordination. Bei hohen Dosen Verlust der zeitlichen und räumlichen Orientierung, Halluzinationen. Allgemein Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen: Beeinträchtigung der Wachsamkeit und der Aufmerksamkeit, besonders bei länger dauernden Aufgaben. Die Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum mit den Gedanken bei einem Problem zu bleiben, geht verloren. Wichtiges wird von Unwichtigem nicht mehr unterschieden. Das Konzentrationsdefizit, die Müdigkeit und das eingeschränktes Reaktionsvermögen bestehen auch als Nachwirkung noch nach Abklingen des akuten Rauschzustandes. Hieraus resultieren typische Fahrfehler wie mangelndes Spurhalten bishin zum Abkommen von der Fahrbahn, Störung von Automatismen, Fehleinschätzung beim Überholen, bei Abständen und bei Geschwindigkeiten sowie das Übersehen von Ampeln und Verkehrszeichen. Wenngleich die Fahrgeschwindigkeit i.d.R. unterdurchschnittlich ist, sind Missachtung von Vorfahrtsregeln beobachtbar, sowie nicht angepasste/fehlende Reaktionen auf Ereignisse am Rande des Gesichtfeldes (spielende Kinder, Fußgänger, etc.) Feldstudien deuten darauf hin, dass bei Blutkonzentrationen bis 5 ng/ml kein statistisch nachweisbar höheres Unfallrisiko besteht; Untersuchungen zu Fehlerquoten in Wahrnehmung und Reaktion zeigen, dass die Fehlerquoten bei Cannabis-Konsumenten mit einem THC-Blutspiegel von ca. 5 ng/ml etwa denen von Alkohol-Konsumenten mit 0,5 Promill BAK entsprechen. Informationen zum Konsumverhalten der Probanden liegen allerdings nicht vor. Mischkonsum von Cannabis und Alkohol resultiert in deutlich erhöhtem Unfallrisiko. Bei chronischem Missbrauch drohen Persönlichkeitsveränderungen, wie bsp. das Amotivationssyndrom; damit einhergehend sind erhebliche Probleme im sozialen Umfeld, wie z.B. der Arbeit oder Schule. Dessen ungeachtet ist in Ausnahmesituationen eine hohe Kompensationsfähigkeit beobachtbar (bsp. bei Polizei-Kontrollen). Zu fast allen Effekten entwickelt sich eine Gewöhnung (Toleranz) mit daraus folgender Neigung zur Hochdosierung und dem Verlangen nach hoher Konsum-Frequenz. Schon einmaliger Konsum kann bei exponierten Personen schwere psychische Störungen auslösen. Studien deuten darauf hin, dass bei solchen exponierten Personen die Wahrscheinlichkeit des Ausbrechens einer psychischen Störung auch nach Absetzen des Konsums erhöht ist. Die Wirkungen des THC werden i.A. durch Alkohol verstärkt. Synergistische Effekte bei Einnahme anderer Drogen werden beobachtet. Ehemalige Cannabis-Konsumenten berichten von Flashbacks. Akute Toxizität: LD50 (Ratte, oral): 666 mg/kg Chronische Toxizität: Chronischer, schwerer Konsum kann zur allgemeiner Antriebsminderung, Rückzug auf die eigene Person, mangelnde Fähigkeit zur Konfliktbewältigung und zu Depressionen führen. Verwirrtheit und Desorientierung, Phobien, Halluzinationen und Panikattacken bishin zu schweren Psychosen sind bei prädisponierten Personen möglich, bzw. die Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch solcher Störungen wird erhöht. Besonders kritisch ist der Konsum bei jungen Menschen zu sehen, weil durch die THC-Wirkungen das Gehirn in seiner Lern- und Entwicklungsfähigkeit gehemmt wird. Entstehende Entwicklungsdefizite lassen sich im späteren Leben nur schwer aufholen. Entzugserscheinungen: Im Allgemeinen wird vorwiegend die Entwicklung einer psychischen Abhängigkeit ausgegangen, während die physische i.d.R. kontrovers diskutiert wird. Dessen ungeachtet berichten regelmäßige Konsumenten nach Beginn der Abstinenz von "innerer Unruhe", Schweißausbrüchen, Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit. Diese akuten Effekte klingen nach wenigen Wochen ab. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 30.10.2007, 22:17 30.10.2007, 22:17
Beitrag
#12
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
11-Hydroxy-Tetrahydrocannabinol
Synonyme: THC-OH, 11-Hydroxy-THC Chemische Gruppe: Cannabinoide Strukturformel und Stäbchenmodell: 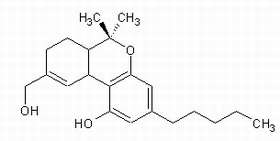 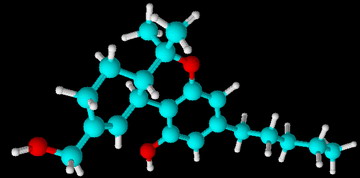 Vorkommen/Verwendung: Primärer Metabolit des THC. Aufnahme: Zu den Aufnahmewegen siehe THC. Während bei inhalativer Aufnahme von Cannabis primär das THC für die psychoaktive Wirkung verantwortlich ist und das THC-OH nur in geringen Konzentrationen vorliegt, wird oral appliziertes THC im oberen Verdauungstrakt resorbiert und zum großen teil direkt in der Leber zu THC-OH aufoxidiert, sodaß bei der oralen Aufnahme das Hydroxy-THC den Hauptwirkstoff darstellt. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Exemplarische Erfahrungen aus der Praxis: Chronischer Konsum, Blutprobe 104 h nach letzter Applikation: 0,4 ng/ml THC-OH Chronischer Konsum, Zeitraum der Blutprobe unbek.: 3,2 ng/ml THC-OH Chronischer Konsum, Blutprobe 4,5 h nach letzter Applikation: 5,6 ng/ml THC-OH. Konsum 4x/Woche, Blutprobe 2,5 h nach letzter Applikation: 5,4 ng/ml THC-OH. Bewertung: THC-OH ist ein Zwischenprodukt, dass bei der Metabolisierung des THC zur THC-Carbonsäure auftritt. Naturgemäß ist die Blutkonzentration i.A. deshalb gering und wird schnell abgebaut. Eine hohe Blutkonzentration dieses Stoffes ist deshalb ein starker Indikator auf zeitnahen Konsum. Metabolisierung: THC-OH wird durch Metabolisierung des THC in der Leber gebildet und dort auch weitgehend schnell weiter zur THC-Carbonsäure oxidiert und so wieder aus dem Blutkreislauf entfernt. Weitere Informationen zur Metabolisierung siehe THC. Wirkungen: Die Wirkung des Hydroxy-THC entspricht derjenigen der psychoaktiven Cannabinoide (siehe hierzu: THC); allgemein wird angenommen, dass THC-OH um das Dreifache psychoaktiv wirksamer ist als THC. Für weitere Informationen zur Wirkung s.a. THC. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 31.10.2007, 20:33 31.10.2007, 20:33
Beitrag
#13
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
THC-Carbonsäure
Synonyme: THC-COOH, Cannabinolsäure, CBS, THC-Säure, THCA, THCS. Ohne Angabe der Substitutionsposition, an der die Carboxy-Funktion hängt, sind mehrere Isomere Formen denkbar. Im Allgemeinen ist aber der Hauptmetabolit des THC gemeint, das 11-Nor-9-carboxy-Δ-9-Tetrahydrocannabinol. Chemische Gruppe: Cannabinoide. Strukturformel und Stäbchenmodell: 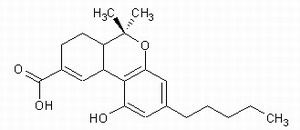 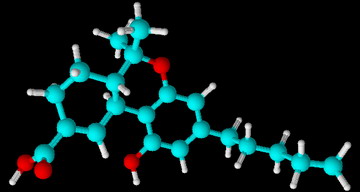 Vorkommen/Verwendung: Hauptmetabolit des THC. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Nachweisbarkeit im Urin: * einmaliger Gebrauch: ca. 1-3 Tage * geringer wöchentlicher Gebrauch (bis 4 mal pro Woche): ca. 4-6 Tage * täglicher Gebrauch: ca. 10-20 Tage * chronischer schwerer Abusus: bis zu 1 Monat und länger Exemplarischer Cut-Off für Urin-Analyse: 25 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Haar-Analyse: 0,05 pg/mg (Pikogramm!) Je nach individuellem Abbauverhalten können die Nachweiszeiten, insbesondere bei regelmäßigem Konsum, deutlich länger sein! Praktische Erfahrung: Chronischer Konsum, Zeitraum nach letzter Applikation unbekannt. THC-COOH: 144,2 ng/ml Blut Chronischer Konsum, Zeitraum nach letzter Applikation: 104 h THC-COOH: 15,9 ng/ml Blut Gelegentlicher Konsum (4x/Woche), Blutprobe 12 h nach letzter Applikation: 1,8 ng/ml THC, 7,8 ng/ml THC-COOH Bewertung: THC-COOH dient als Langzeitmarker für Cannabis-Konsum. Um Anhaltspunkte für das Konsumverhalten zu erlangen, wird zwischen zeitnaher Kontrolle nach dem Konsum und zeitversetzter Screening-Untersuchung unterschieden: Zeitnahe Blutentnahme: > 150 ng/ml --> regelmäßiger Konsum > 10 ng/ml --> gelegentlicher Konsum Bewertung nach Daldrup (bei zeitversetzter (ggf. mehrere Tage) Blutentnahme): >75 ng/ml --> Regelmäßiger Konsum. 5-75 ng/ml --> Gelegentlicher Konsum, Verdacht auf regelmäßigen Konsum. < 5 ng/ml --> Einmaliger oder gelegentlicher Konsum; in Verbindung mit aktivem THC folgt daraus, daß sowohl eine akute, wie auch eine vergangene Applikation vorliegt und somit der Konsum mindestens „gelegentlich“ ist. Für weitere Informationen zur Bewertung von Cannabinoid-Analysen siehe THC. Metabolisierung: THC-COOH entsteht schnell durch die Metabolisierung des Hauptwirkstoffs der Cannabis-Pflanze über die Zwischenstufe des Hydroxy-THCs. Die THC-Carbonsäure lagert sich sehr gut im Fettgewebe ab und wird dort akkumuliert. Der überwiegende Teil der Carbonsäure wird direkt ausgeschieden; der Rest wird weiter hydroxyliert und glucuronidiert. Durch die Akkumulation der THC-Carbonsäure im Körper eignet sich die Blutkonzentration dieses Cannabinoids gut als Indikator für das Konsumverhalten. Exemplarisch ist die folgende Korrelation/Hochrechnung von Blutkonzentration und Konsumfrequenz nach Aderjan (wobei der Autor darauf hinweist, dass individuelle Faktoren das tatsächliche Ergebnis eines Probanden stark beeinflussen können): 1-5 Konsumtage pro Monat --> 40 ng/ml 6-9 Konsumtage pro Monat --> 40-50 ng/ml 10-19 Konsumtage pro Monat --> 50-70 ng/ml 20-30 Konsumtage pro Monat --> >70 ng/ml Für weitere Informationen zur Metabolisierung siehe THC. Wirkungen: THC-Carbonsäure selbst ist nicht psychoaktiv. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 01.11.2007, 18:55 01.11.2007, 18:55
Beitrag
#14
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Ecstasy
Ecstasy (XTC) ist keine klar definierbare Substanz, sondern ein Drogencocktail unterschiedlicher Zusammensetzung, i.d.R. auf Amphetamin-Derivaten (derzeit in Deutschland sehr häufig MDMA) basierend. Der Wirkstoff kann einerseits durch neutrale oder andere Wirkstoffe gestreckt oder mit anderen Drogen versetzt sein, um den Kick oder das Suchtpotenzial zu steigern oder Nebenwirkungen zu bekämpfen, wobei sich dieses „Bekämpfen“ nicht auf medizinisch sinnvolle Maßnahmen bezieht, sondern auf die subjektiv empfundenen negativen Auswirkungen des Konsums. Durch solche Mischpräparate können jedoch die toxischen Nebenwirkungen unberechenbar werden. Ebenso können die psychischen Wirkungen individuell unbefriedigend oder äußerst negativ empfunden werden. Verwendete Wirkstoffe sind z.B.: Amphetamin, MDMA (zu einem maßgeblichen Anteil), Methamphetamin, Atropin, Coffein, Ephedrin, MDE, Phentermin, mitunter auch Benzodiazepine. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 02.11.2007, 21:14 02.11.2007, 21:14
Beitrag
#15
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Amphetamin
CAS-Nr.: 300-62-9 EG-Nr.: 206-096-2 RTECS-Nr.: SH9000000 Synonyme: Amfetamin, (RS)-1-Phenylpropan-2-ylazan, α-Methylphenethylamin, Phenylisopropylamin, 1-Phenylpropan-2-amin, Speed, Pep. Durch Protonierung der Amino-Gruppe ist der Stoff leicht in ein Salz überführbar (Amphetamin-sulphat, Amphetamin-phosphat, Amphetamin-hydrochlorid, etc.), verhält sich aber im Körper wie das reine Amphetamin. Verschiedene Amphetamin-Salze werden bsp. vertrieben unter den Markennamen Actemin, Aktedron, Benzedrine, Dexedrine, Adderall Chemische Gruppe: Amphetamine. Das Phenylisopropylamin ist die Stammverbindung einer ganzen Klasse von Wirkstoffen, die Formal durch Derivatisierung aus der Leitstruktur abgeleitet werden können. Die grundsätzliche Wirkungsweise als Weckamine und Aufputschmittel ist bei allen Stoffen dieser Verbindungsklasse ähnlich, wenngleich die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik durch die Einführung weiterer funktioneller Gruppen oder Strukturelemente in Teilbereichen gravierend beeinflusst werden kann. Das enorme Wirkpotenzial der Leitstruktur prädestiniert die Amphetamine zu „Designer-Drogen“: Die chemische Synthese geringfügig strukturveränderter Amphetamine ist einfach, sodaß schnell gesetzliche Verbote in Form von Listen mit definierten Stoffen unterlaufen werden können. Während die gebräuchlichsten und billigsten Amphetamine in einschlägigen Verbotslisten aufgeführt sind (z.B. BtmG), ist „exotischeren“ Derivaten nur über „weichere“ Gruppendefinitionen beizukommen, wie z.B. über die Wirkungsbeschreibung „psychoaktive Stoffe“. Strukturformel und Stäbchenmodell: 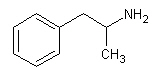  Vorkommen/Verwendung: Farbloser Feststoff mit Schmelzpunkt 27 °C (kann durch Verunreinigungen erniedrigt sein). Amphetamin wird i.d.R. als Sulphat oder Hydrochlorid in verkehr gebracht; die Salze sind weißliche Pulver, häufig formuliert als Kapseln oder Pillen. Medizinische Verwendung gegen Narkolepsie, ADS/ADHS. Die Verwendung als Diätmittel und Appetitzügler sowie als Asthma-Mittel ist wegen der starken Nebenwirkungen bedenklich und erfolgt i.d.R. nicht mehr. Missbrauch erfolgt durch die Verwendung als Doping-Mittel und als euphorieerzeugende sowie leistungssteigernde Party-Droge (Aufputschmittel). Aufnahme: Oral als Pille oder Getränke-Beimischung, Schnupfen, Injektionen. Einnehmbare Mittel haben unterschiedlichste Konzentrationen. Einzeldosis 5-15 mg, 30 mg sind für Gelegenheitskonsumenten eine hohe Dosis. Bei Gewöhnung kann die Dosis um ein Vielfaches höher liegen: Bis 50-100 mg bei Extremkonsumenten, in Extremfällen Tagesdosen von mehr als 2 g. Bei Alkalisierung des Harns kann es zu Rückresorptionen kommen. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für Amphetamine: 300-1000 ng/ml (abhängig von Methode und Fragestellung) Exemplarischer Cut-Off für Urin: 200 ng/ml Nachweisbarkeit im Blut: ca. 1 Tag Nachweisbarkeit im Urin: Innerhalb von 20 min. nach der Aufnahme ist Amphetamin für 1 – 4 Tage im Urin nachweisbar:
Langzeitnachweis über Haaranalyse; exemplarischer Cut-Off: 0,5 ng/mg. Die GTFCh (2009) gibt folgende Nachweisgrenzen für forensische Erfordernisse an (die Serum/Plasma-Werte erfüllen die Vorgaben der Grenzwertkommission bzgl. § 24a (2) StVG): Amphetamin --> 25 ng/ml (Serum/Plasma), 200 ng/ml (Urin), 0,1 ng/mg (Haare) Praktische Erfahrungen: 7 h nach Ecstasy-Applikation: 38 ng/ml Blut (neben 276 ng/ml MDMA) Schnelltests können falschpositive Ergebnisse liefern bei Einnahme von:
Bewertung: Sowohl im akuten Rausch, als auch während des Entzugs massive Beeinträchtigung der Fahreignung; gilt als „harte Droge“. Amphetamin ist ein berauschendes Mittel im Sinnes der Anlage zum §24a StVG (Empfehlung der Grenzwertkommission: 25 ng/ml). Amphetamin ist Bestandteil der Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel) Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt Metabolisierung: Die Metabolisierungs- und Exkretionsraten sind pH-abhängig: Saurer pH erhöht, alkalischer pH senkt die Ausscheidung im Urin, wobei auch der Anteil der Stoffumwandlung beeinflusst wird: Bei saurem pH wird innerhalb 24 h bis zu 78 % des Amphetamins ausgeschieden, dabei ca. 68 % unverändert; bei alkalischem pH werden dagegen nur 45 % ausgeschieden, dabei nur 2 % unverändert. Ursache hierfür ist eine Rückresorption des unprotonierten, unveränderten Amins aus dem alkalischen Urin, während im Sauren das protonierte, hydrophile und lipophobe Ammoniumsalz nicht in diesem Maße rückresorbiert wird. Halbwertszeit für die Eliminierung beträgt ca. 10-30 h. Innerhalb von 20 min. nach der Aufnahme ist Amphetamin im Urin nachweisbar. 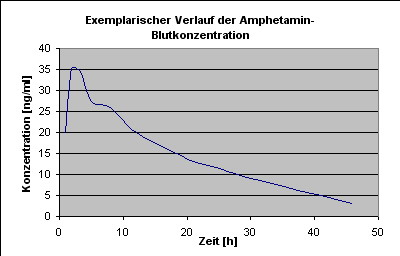 Die Abbildung ist erstellt auf Basis abgelesener Werte aus Diagrammen von Sekundärliteratur, die sich auf eine Publikation von P.X. Iten bezieht. In der Studie wurden 10 mg Amphetamin-sulphat oral appliziert. Die Metabolisierung verläuft primär über eine Hydroxylierung des Amphetamins, die an verschiedenen Stellen erfolgen kann. Charakteristische Metaboliten im frühen Stadium sind z.B.: 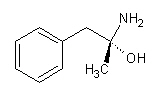 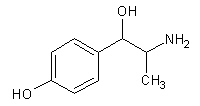 Die Hydroxy-Gruppen werden im Weiteren glucuronidiert; alternativ erfolgt oxidative Desaminierung und schrittweiser Abbau der Seitenkette zu Benzoesäure. Die skizzierte Metabolisierungs-Route wird regelmäßig auch von Amphetamin-Derivaten mit unverändertem Stammgerüst und unterschiedlich substituiertem terminalem Stickstoff durchlaufen, wie z.B. Ethylamphetamin, Cyclobenzorex, Mefenorex, Fenproporex, Amfetaminil, Fenetyllin, Fencamin oder Benzphetamin. Wirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkungseintritt nach oraler Einnahme innerhalb von 20-40 Minuten; Wirkungsdauer 2 - 4 h, manchmal bis zu 6 h. Wirkungseintritt nach Schnupfen innerhalb von 0,5-2 Minuten; Wirkungsdauer 4-5 h, bei entwickelter Toleranz deutlich kürzer. Symptome: Erweiterte Pupillen, Sehstörungen, Schweißausbrüche, Mundtrockenheit, Geschwätzigkeit, beschleunigter Herzschlag bishin zum Herzrasen, Hautblässe, erhöhte Körpertemperatur/Fieber, Zittern. Nervosität und erhöhte Aggressivität, Schlafstörungen, Angst, Halluzinationen, Verfolgungswahn. Wirkungsweise: Amphetamin wird als Sympathomimetikum eingesetzt und wirkt stimulierend auf das vegetative Nervensystem. Das vegetative Nervensystem ist verantwortlich für die Steuerung lebenswichtiger Körperfunktionen wie Herzschlag, Blutdruck, Atmung, Verdauung und Stoffwechsel, wirkt aber auch auf Blutgefäße, Sexualorgane und Augenmuskeln. Die Einnahme von Wirkstoffen, die auf dieses Nervenzentrum zielen, erfordert deshalb sorgfältige medizinische Kontrolle. Mit den primären Eindrücken bei der Einnahme von Sympathomimetika wie Euphorie und Leistungssteigerung gehen Erhöhung von Blutdruck und Herzfrequenz, Erweiterung von Atemwegen und Appetit-Verminderung bei gleichzeitig erhöhtem Energieverbrauch einher. Bei Amphetamin-Verabreichung werden insbesondere die körperlichen Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Müdigkeit und Schmerzen ausgeschaltet, bei gleichzeitiger Steigerung von Kraft, Schnelligkeit und Libido. Unkontrollierte Einnahme kann somit zu einer völligen Entkräftung und Dehydrierung führen: Dem Körper werden Nährstoffe durch erhöhte Aktivität entzogen, ohne daß ein Bedürfnis entsteht, diese Nährstoffe nachzuführen. Plötzlicher Zusammenbruch kann die Folge sein. Amphetamin ist psychoaktiv. Nach der Einnahme wird das Selbstbewusstsein übersteigert, euphorische Zustände werden erreicht und die Aggressionsschwelle wird gesenkt. Verwirrtheit und Realitätsverlust können auftreten. Kennzeichnend sind motorische Unruhe, Enthemmung und erhöhte Risikobereitschaft, Fehleinschätzungen und sogar Realitätsverlust. Nach Abklingen der stimulierenden Wirkungen stellt sich häufig Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Erschöpfung und Depression ein, die zu erneutem Konsum verleitet, um die negativen Begleiterscheinungen durch die als positiv empfundenen Wirkungen zu unterdrücken. Hierdurch entsteht das hohe Suchtpotenzial und die Gefahr massiver psychischer Abhängigkeit. Durch Gewöhnung besteht Tendenz zur Dosiserhöhung. Akute Toxizität: LD50 (oral, Ratte) = 55 mg/kg (giftig nach Stoffrecht) Tödliche Dosis beim Menschen: 1,3 mg/kg Körpergewicht, gewöhnungsabhängig. Illegal hergestelltes Amphetamin kann synthesebedingt sehr giftige Verunreinigungen enthalten, die akut und chronisch extrem schädliche Nebenwirkungen aufweisen. Neben den neagtiven psychischen Nebenwirkungen können Herzrhythmusstörungen und Herzinfarkte eintreten; Atemdepression und Krampfanfälle sind möglich. Chronische Toxizität: Nebenwirkungen bei chronischer Einwirkung bestehen u.a. in Nierenschäden, Schäden am Verdauungstrakt bishin zum Magendurchbruch, Nervenschäden, Verlust von Zahnschmelz und Zähnen sowie Knochenschwund (Calciummangel-Symptome), Potenzstörungen sowie Psychosen und paranoiden Wahnvorstellungen mit einer ähnlichen Symptomatik wie Schizophrenie. Untersuchungen weisen auf neurotoxische Hirnschäden hin. Missbildungen bei ungeborenen Kindern sind möglich. Entzugserscheinungen: Plötzliches Absetzen nach chronischer Einnahme führt zu Entzugserscheinungen in Form von dramatischem Leistungsabfall, Lethargie, Apathie, Angstzuständen und Depressionen bishin zu Selbstmordtendenzen. Die Symptome werden i.A. nach zwei Wochen überwunden, in Einzelfällen wird bedeutend mehr Zeit benötigt. Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 11.12.2016, 12:28 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 03.11.2007, 21:35 03.11.2007, 21:35
Beitrag
#16
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Methamphetamin
CAS-Nr.: 7632-10-2, 33817-09-3, 537-46-2 EG-Nr.: 231-559-0, 251-687-0, 208-668-7 RTECS-Nr.: SH4910000 Synonyme: N-Methyl-1-phenylpropan-2-amin, N-Methylamphetamin, MA, Desoxyephedrin, (S)-(Methyl-)(1-phenylpropan-2-yl)azan Yaba, Crystal, Chrystal Speed, Ice, Meth, Chrystal Meth, Cranck, Vint, Chili, Perlik, Pernik, Shabu, Crank. Pervitin, Methedrine, Desoxyn, Temmler, Methampex. Häufig in Form des Hydrochlorids. Chemische Gruppe: Amphetamine Strukturformel und Stäbchenmodell: 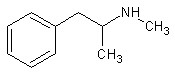  Vorkommen/Verwendung: Medizinische Anwendungen selten und in kleinen Dosen zur Dilatation der Bronchen oder zur Steigerung motorischer Fähigkeiten nach Unfällen mit Hirnschädigung; Psychostimulanz und Weckamin. Methamphetamin wird in Deutschland nur in Ausnahmefällen verabreicht. Missbrauch erfolgt durch die Verwendung als euphorieerzeugende sowie leistungssteigernde Party-Droge (Aufputschmittel). Aufnahme: Oral als Pille oder Getränke-Beimischung, Schnupfen, Inhalieren (wg. des niedrigen Siedepunktes gut verdampfbar), Injektion. Bereits in Dosierungen von 10 mg deutliche und langanhaltende Wirkungen; üblich sind Einzeldosen von 20-30 mg Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Nachweisbarkeit im Urin: 1 – 6 Tage. * bis ca. 24 h nach 1x oraler Dosis * bis zu 4 Tage nach chronischem Missbrauch Langzeitnachweis über Haaranalyse: 0,5-1,10 ng/mg Haar gelten als positiv; zur Ermittlung von Metaboliten-Verhältnissen liegt der Cut-Off bei 0,05 ng/mg. Unter diesen Bedingungen ist Konsum von 170-630 mg/Woche nachweisbar. Metamphetamin metabolisiert über die gleichen Abbauprodukte wie Amphetamin. Die GTFCh (2009) gibt folgende Nachweisgrenzen für forensische Erfordernisse an (die Serum/Plasma-Werte erfüllen die Vorgaben der Grenzwertkommission bzgl. § 24a (2) StVG): Methamphetamin --> 25 ng/ml (Serum/Plasma), 200 ng/ml (Urin), 0,1 ng/mg (Haare) Erfahrungen aus der Praxis: 7,5 h nach Applikation: <4,0 ng/ml Blut Amphetamin, 142 ng/ml Blut Methamphetamin. Bewertung: Methamphetamin ist ein berauschendes Mittel im Sinnes der Anlage zum §24a StVG (Empfehlung der Grenzwertkommission: 25 ng/ml). Methamphetamin ist Bestandteil der Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: Methamphetamin wird u.a. über die Stufe Amphetamins metabolisiert. Einleitender Schritt ist die N-Demethylierung. Nachweisbare Metaboliten neben ca. 44 % unverändert ausgeschiedenem Methamphetamin:sind z.B.: 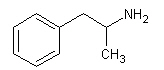 Amphetamin (6-20 %) Amphetamin (6-20 %)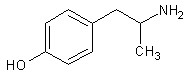 4-Hydroxyamphetamin (10 %) 4-Hydroxyamphetamin (10 %)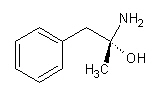 α-Hydroxyamphetamin α-Hydroxyamphetamin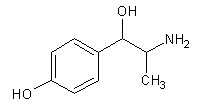 4-Hydroxynorephedrin 4-HydroxynorephedrinVon großer Bedeutung bei der Ausscheidung ist der pH-Wert des Urins: Während im sauren Bereich das Amin in kationischer, protonierter Form vorliegt und dadurch sehr gut wasserlöslich ist, wird es im alkalischeren Bereich zunehmend deprotoniert und erhöht dadurch seine Lipid-Löslichkeit. Hierdurch kann es in alkalischem Urin zu einer Rückresorption des Methamphetamins in den Blutkreislauf kommen. Wirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkeintritt und –dauer sind abhängig von der Konsumform: Schnupfen: Wirkung nach 3-10 Min., bei einer Dosis von 10 mg bis zu 20 h anhaltend, bei 30 mg oft heftige Halluzinationen über einen Zeitraum von 20-30 h (!). Oral: Wirkeintritt nach 30-40 Min. Einzelne Effekte können noch bis zu 70 Stunden nach der Applikation eintreten. Symptome: Erweiterte Pupillen, Augenrollen, Wangenschmerz, Kaureflex, trockener Mund. Kribbeln unter der Haut (“Insektenlaufen“), motorische Unruhe, Tremor (Muskelzittern), erhöhte Körpertemperatur. Gesteigertes Selbstbewusstsein, Aggressivität, Egozentrik, verminderte Kritikfähigkeit. Wirkungsweise: Metamphetamin ist wie Amphetamin ein Psychostimulanz und durch die methylierte Aminogruppe lipohiler als die Stammverbindung Amphetamin. Das rausch- und suchterzeugende Potenzial von MA ist höher als beim Amphetamin; Wirkungsdauer und –Intensität sind ebenfalls höher. Bei Verabreichung von Methamphetamin werden insbesondere die körperlichen Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Müdigkeit und Schmerzen ausgeschaltet, bei gleichzeitiger Steigerung von Kraft, Schnelligkeit und Libido. Unkontrollierte Einnahme kann somit zu einer völligen Entkräftung und Dehydrierung führen: Dem Körper werden Nährstoffe durch erhöhte Aktivität entzogen, ohne daß ein Bedürfnis entsteht, diese Nährstoffe nachzuführen. Plötzlicher Zusammenbruch kann die Folge sein. Akute Toxizität: LD50(subcutan, Ratte) = 10,93 mg/kg LD50(Affe) = 15-20 mg/kg, bei Jungtieren 5 mg/kg. Chronische Toxizität: Nierenschäden, Potenzstörungen, Zahnschäden und Zahnausfall (Meth Mouth). Blutverdickung und Blutdrucksteigerung, die zu herzrhythmusstörungen, Schlaganfällen und Herzstillstand führen kann. Magenschmerzen und Magendurchbruch, Organbluten. Schlafstörungen, Angstzustände, paranoide Wahnvorstellungen, Ausbruch einer bisher latenten Schizophrenie. Schwere Nervenschädigung, Auslösung von Parkinson. Ausgeprägte Toleranzausbildung, hierdurch induziert starke Neigung zur Dosiserhöhung. Entzugserscheinungen: Methamphetamin führt schnell zu starker psychischer Abhängigkeit. Extremes Schlafbedürfnis und Trägheit, Depressionen, starker Hunger. Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 11.12.2016, 12:29 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 04.11.2007, 20:11 04.11.2007, 20:11
Beitrag
#17
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Ephedrin
CAS-Nr.: 299-42-3 Synonyme: (1R,2S)-2-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol Ephis. Amidrin, Fluidin, Tedral, Daral. “Pseudoephedrin” ist das Enantiomer des Ephedrins. Chemische Gruppe: Amphetamine Strukturformel und Stäbchenmodell: 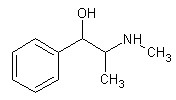 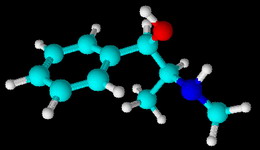 Vorkommen/Verwendung: Farbloser Feststoff. Medizinischer Einsatz als Bronchdilator bsp. in Hustensaft oder zur Behandlung von Asthma-Anfällen. Früher Einsatz bei Kreislaufschwäche (Hypotonie) und Narkolepsie; Verwendung bei Augen-Untersuchungen (Pupillenerweiterung, ähnlich Atropin) und als Appetitzügler sowie in Nasenspray. Einsatz als schwaches Weck-Amin. Missbrauch als Appetitzügler, Partydroge und Doping-Mittel. Vorkommen in reiner Form bzw. als Hydrat, sowie auch als Hydrochlorid oder Sulphat. Bestandteil des Ephedra-Krauts (Herba Epherdae) zu geringen Prozentanteilen (i.d.R. < 4%). Aufnahme: Applikation i.d.R. oral in Pillenform oder nasal. Ephedrin ist für medizinische Zwecke aber auch transdermal oder in Form von Augentropfen und Sprays applizierbar. Einzeldosierung 25-50 mg, bei medizinischer Verwendung z.B. als Bronchiodilator mit bis zu 4 Applikationen pro Tag. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Nachweis erfolgt aus dem Blut oder Urin. Erfahrungswerte: 14 Stunden nach Einnahme einer regulären Dosis von Wick MediNait reagiert ein Schnelltest auf Amphetamine positiv (Anorca). Bewertung: Ephedrin ist nicht in den Anhängen des BtmG aufgeführt, unterliegt aber dem Grundstoffüberwachungsgesetz, weil es als Ausgangsstoff zur Methamphetamin-Gewinnung verwendet werden kann. Metabolisierung: Ephedrin wird gut über den Verdauungstrakt resorbiert. Das Maximum der Plasmakonzentration wird ca 1 h nach oraler Applikation erreicht (ca. 0,1 µg/ml bei einer Dosis von 24 mg). In Abhängigkeit vom pH-Wert des Urins beträgt die Plasmahalbwertszeit ca. 3-6 h (Rückresorption des Wirkstoffes aus dem alkalischen Urin, wie auch bei anderen Amphetaminen). Ephedrin wird zum größten Teil innerhalb 48 h unmetabolisiert ausgeschieden (70-80 %). Nur ein kleiner Teil wird in der Leber umgewandelt. Ursache könnte ähnlich wie beim Methylphenidat der Substituent am ringvicinalen Kohlenstoff sein. Sofern Metabolisierung erfolgt, wird das Ephedrin primär N-demethyliert und in Form des Norephedrins ausgeschieden. 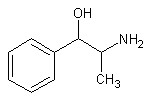 Norephedrin NorephedrinWirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkdauer 4-6 h. Symptome: Erweiterte Pupillen und verlangsamte Pupillen-Licht-Reaktion auf Beleuchtung (Mydriasis). Erhöhte Körpertemperatur und Herzschlag (Puls), vermehrtes Schwitzen, Übelkeit und Erbrechen; erhöhter Blutdruck. Gesteigerte motorische Aktivität, Verwirrtheit. Wirkungsweise: Ephedrin stimuliert das Zentralnervensystem und wirkt ähnlich wie ein Aufputschmittel; es ist subjektiv leistungssteigernd, mitunter euphorisierend und aphrodisierend. Es kann zu Muskelzittern, Krämpfen und Atemproblemen, mitunter zu Herzanfällen kommen. Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Verwirrtheit, Angstzustände, Halluzinationen und Delierium sind möglich. Akute Toxizität: Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmusstörungen. Gefahr von Hirnblutungen bei missbräuchlicher Überdosierung. Schwere Vergiftungserscheinen werden insbesondere bei Mischkonsum mit Koffein berichtet. Chronische Toxizität: Potenzstörungen; schwere Kontakt-Dermatitis nach Hautkontakt und auch nach oraler Applikation möglich. Gefahr von paranoiden Psychosen mit Halluzinationen schon bei chronischer, relativ schwacher Überdosierung. Gefahr von Störungen des Herz-Kreislaufsystems, Herzinfarkten und Hirnschlag. Ephedrin akkumuliert in Muttermilch. Toleranzentwicklung und Gefahr von Abhängigkeit. Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 15.06.2011, 22:57 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 05.11.2007, 20:08 05.11.2007, 20:08
Beitrag
#18
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
MDA
CAS-Nr.: 4764-17-4 Synonyme: 3,4-Methylendioxyamphetamin, (RS)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-ylazan. Tenamfetamin Love-Drug, Hug-Drug. Ecstasy, XTC; zwar wird der Begriff Ecstasy primär mit MDMA in Verbindung gebracht, aber MDA kann den Ecstasy-Pillen beigemengt sein oder das MDMA auch ersetzen. Aufgrund der uneindeutigen technischen Kurzbezeichnung „MDA“ kann es zu Verwechselung mit dem toxischen Stoff Methylendianilin kommen. Chemische Gruppe: Amphetamin Strukturformel und Stäbchenmodell: 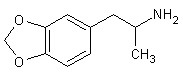  Vorkommen/Verwendung: Früher Einsatz in der Psychotherapie, um den Patienten zu „öffnen“. Inzwischen keine medizinisch-therapeutische Anwendungsmöglichkeit mehr. Aufnahme: Orale, seltener nasale Applikation; Einzeldosis: 60-100 mg. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Die GTFCh (2009) gibt folgende Nachweisgrenzen für forensische Erfordernisse an (die Serum/Plasma-Werte erfüllen die Vorgaben der Grenzwertkommission bzgl. § 24a (2) StVG): MDA --> 25 ng/ml (Serum/Plasma), 200 ng/ml (Urin), 0,1 ng/mg (Haare) Praktische Erfahrung: 3-5 h nach Applikation 20 ng/ml Blut (+ 280 ng/ml MDMA) Bewertung: MDA ist ein berauschendes Mittel im Sinnes der Anlage zum §24a StVG (Empfehlung der Grenzwertkommission: 25 ng/ml). MDA ist Bestandteil der Anlage I des Betäubungsmittelgesetzes (nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: MDA wird zum großen Teil im Urin unverändert nachgewiesen. Metabolisierung kann erfolgen durch Öffnung des Dioxol-Ringes; die verschiedenen Bruchstücke (z.B. Dihydroxyamphetamin) werden glucuronidiert. Die Metabolisierungs-Route kann in Teilen mit der des es Amphetamins zusammenfallen. Wirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkeintritt nach 30-60 Minuten, bei einer Wirkdauer von 8-12 h. Symptome: Gesteigertes Redebedürfnis, erweiterte Pupillen, Augenzittern und Lichtempfindlichkeit. Mundtrockenheit, gesteigerte Atemfrequenz, erhöhte Körpertemperatur, Brechreiz und Schwindel. Schweißausbrüche, Harndrang. Erhöhter Puls und Blutdruck, Muskelzittern. Orientierungslosigkeit. Wirkungsweise: Aufputschendes, sympathomimetisches Psychostimulans mit empatischer und entaktogener Wirkung, ähnlich dem MDMA, wenngleich schwächer; charakteristisch ist dagegen die mitunter intensive halluzinogene Wirkung. Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Aktivität bei Unterdrückung von Hunger-, Durst- und Müdigkeitsgefühlen. Intensivierte Farbwahrnehmung, Euphorie und psychedelisches Glücksgefühl. Die MDA-Wirkung wird offenbar als „härter“ empfunden als beim MDMA. MDA wirkt dehydrierend, bei gleichzeitiger Steigerung des Grundumsatzes. Unkontrollierte Einnahme kann somit zu einer völligen Entkräftung, Dehydrierung und Überhitzung führen: Dem Körper werden Nährstoffe durch erhöhte Aktivität entzogen, ohne daß ein Bedürfnis entsteht, diese Nährstoffe nachzuführen. Der Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalt entgleist und plötzlicher Zusammenbruch kann die Folge sein. Depressive Phasen nach Abklingen des akuten Rauschzustandes. Starke Toleranzentwicklung bzgl. der psychoaktiven Wirkung. Gefahr von psychischer Abhängigkeit. Akute Toxizität: Herzrhythmusstörungen und Hyperthermie, ähnlich MDMA. Chronische Toxizität: Hirn- und Lebertoxizität. Neurotoxischer als MDMA mit Gefahr der dauerhaften Schädigung des Zentralnervensystems (Serotonin-Verarmung). Gefahr schizophrenieähnlicher Symptome Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 11.12.2016, 12:30 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 06.11.2007, 19:53 06.11.2007, 19:53
Beitrag
#19
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
MDMA
CAS-Nr.: 69610-10-2; 66142-89-0; 42542-10-9; 81262-70-6 Synonyme: 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin, Methylendioxymetamfetamin, (1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-yl)(methyl-)azan. ADAM. Ecstasy, XTC. Ecstasy-Pillen enthalten inzwischen häufig kein reines MDMA mehr, sondern können mit anderen Wirkstoffen kombiniert oder gestreckt sowie durch andere Stoffe ersetzt sein. Chemische Gruppe: Amphetamine Strukturformel und Stäbchenmodell: 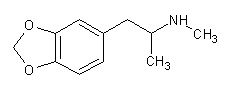 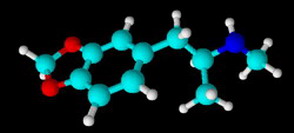 Vorkommen/Verwendung: Frühe Verwendung Schlankheitsmittel (1914); Hilfsmittel in der Psychotherapie aufgrund empathogener und entaktogener Wirkung, inzwischen weitgehend verboten. Häufiger Hauptbestandteil von Ecstasy; Konsumierung als Aufputschmittel und zur Enthemmung. Aufnahme: Oral als Pille oder in Getränken aufgelöstes Pulver. Schniefen. Die wirksame Dosis liegt bei etwa 80-150 mg. In einer Ecstasy-Pille beträgt der Gehalt an MDMA ca. 50 - 200 mg, in seltenen Fällen bis 250 mg. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Zum Screening werden Immunoassays verwendet, zur quantitativen Bestätigung (meist im Blut) GC/MS. Nachweisbarkeit * Im Blut bis 1 Tag, * Im Urin bis ca. 3 d Die GTFCh (2009) gibt folgende Nachweisgrenzen für forensische Erfordernisse an (die Serum/Plasma-Werte erfüllen die Vorgaben der Grenzwertkommission bzgl. § 24a (2) StVG): MDMA--> 25 ng/ml (Serum/Plasma), 200 ng/ml (Urin), 0,1 ng/mg (Haare) Praktische Erfahrungen: 7 h nach Ecstasy-Applikation: 276 ng/ml Blut (neben 38 ng/ml Amphetamin) 3-5 h nach 2 XTC-Pillen. 280 ng/ml Blut 24 h nach Applikation: 54 ng/ml Blut Bewertung: MDMA ist ein berauschendes Mittel im Sinne der Anlage zum §24a StVG (Empfehlung der Grenzwertkommission: 25 ng/ml). MDMA ist Bestandteil der Anlage I des Betäubungsmittelgesetzes (nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: MDMA wird größtenteils unverändert ausgeschieden. Metabolisierung wird durch Demethylierung oder durch Öffnung des Dioxol-Ringes eingeleitet; die verschiedenen Bruchstücke (z.B. Dihydroxyamphetamin) werden glucuronidiert. Die Metabolisierungs-Route verläuft u.a. über das MDA (ca. 7% einer MDMA-Dosis werden als MDA ausgeschieden) und kann in Teilen mit der des es Amphetamins zusammenfallen. 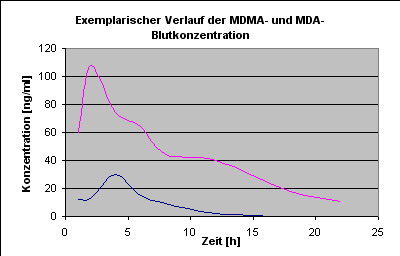 Die Abbildung ist erstellt auf Basis abgelesener Werte aus Diagrammen von Sekundärliteratur, die sich auf eine Publikation von P.X. Iten bezieht. In der Studie wurden 50 mg MDMA oral appliziert. Nachweisbare Metaboliten sind z.B.: 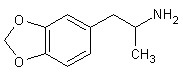 MDA MDA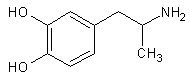 3,4-Dihydroxyamphetamin 3,4-DihydroxyamphetaminWirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkungseintritt bei oraler Applikation nach etwa 20-60 Min. Wirkdauer 1-6 h. Symptome: Erweiterte Pupillen, Augenzittern und Lichtempfindlichkeit. Mundtrockenheit, gesteigerte Atemfrequenz, erhöhte Körpertemperatur, Brechreiz und Schwindel. Schweißausbrüche, Harndrang. Zittern der Kiefer-Muskulatur und Zähneknirschen; Krampfen der geschlossenen Augenlider. Kribbeln unter der Haut („Insektenlaufen“; wird aber häufig noch als angenehm empfunden). Erhöhung von Herzfrequenz und Blutdruck. Koordinationsstörungen. Motorische Unruhe. Potenzstörungen, Muskelzuckungen und –krämpfe. Wirkungsweise: MDMA ist ein psychoaktiver Wirkstoff mit empathogener und entaktogener Wirkung. Die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme mit anderen Personen sinkt und die eigene Stimmungslage wird verstärkt (ins Positive wie auch ins Negative). Dies kann je nach Prädisposition zu Ausgeglichenheit und Harmoniegefühl, Kommunikations- und Kontaktfreudigkeit, Euphorie und gesteigertem Selbstbewusstsein, aber auch zu Beziehungswahn, Depressionen, Panikattacken und Todesangst führen. MDMA wirkt dehydrierend, bei gleichzeitiger Steigerung des Grundumsatzes. Unkontrollierte Einnahme kann somit zu einer völligen Entkräftung, Dehydrierung und Überhitzung führen: Dem Körper werden Nährstoffe durch erhöhte Aktivität entzogen, ohne daß ein Bedürfnis entsteht, diese Nährstoffe nachzuführen. Der Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalt entgleist und plötzlicher Zusammenbruch kann die Folge sein. Charakteristisch für MDMA ist die extreme Steigerung der Körpertemperatur, die auf 40-42 °C steigen kann („Hyperpyrexie“). Mit der Steigerung der Temperatur geht Muskelsteifheit und sogar Muskelzerfall („Rhabdomyolyse“) sowie Nierenversagen einher. Bei Überdosierung ist Herzversagen möglich, selbst bei frühzeitiger Erkennung und intensivmedizinischer Betreuung. MDMA erzeugt psychische Abhängigkeit. Akute Toxizität: Durch extreme Steigerung der Körpertemperatur und Dehydrierung kann es zur Blutgerinnung in den Adern kommen, die sich durch Nasenbluten und Blutungen im Bauchraum bemerkbar macht. Erfahrungen am Menschen: Anscheinend besteht keine direkte Ursachen-Wirkungsbeziehung zwischen Blutspiegel und auftretender Hyperpyrexie. Während einerseits ein Fall mit einem Blutspiegel von 7,7 µg/ml Blut ohne Symptome dokumentiert ist, führte in einem anderen Fall die Einnahme von 10 Ecstasy-Pillen bei einem Spiegel von 2,3 µg/ml Blut zum Tode (s. „Tödliches Fieber durch MDMA“ auf der Website der Informationszentrale gegen Vergiftungen der Universität Bonn) Chronische Toxizität: Neuronale Schädigungen, degenerative Wirkung auf das Hirngewebe. Kognitive Beeinträchtigungen (Lernfähigkeit, Merkfähigkeit) bei prädisponierten Personen, insbesondere bei langzeit- und/oder schwerem Konsum. Gegenüber der bewusstseinserweiternden und aufputschenden Wirkung stellt sich bei chronischem Konsum Torleranz ein, die auch durch Erhöhung der Dosis nicht kompensiert wird; dagegen steigt das Risiko von Nebenwirkungen jedoch an. Am Affen wurden bei sehr hohen Dosen bleibende Schäden am zentralen Nervensystem nachgewiesen. Entzugserscheinungen: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Depressionen. Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 08.01.2019, 20:29 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 07.11.2007, 21:34 07.11.2007, 21:34
Beitrag
#20
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
MDE
CAS-Nr.: 74341-78-9 RTECS-Nr.: DF4914530 Synonyme: N-Ethyl-3,4-methylendioxyamphetamin, MDEA, Methylendioxyethylamfetamin, N-Ethyl-MDA, (1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan(N-Ethyl-MDA,MDE,MDEA)-2-yl)(ethyl)azan Eve. Ecstasy, XTC; zwar wird der Begriff Ecstasy primär mit MDMA in Verbindung gebracht, aber MDE kann den Ecstasy-Pillen beigemengt sein oder das MDMA auch ersetzen. Chemische Gruppe: Amphetamin-Derivate Strukturformel und Stäbchenmodell: 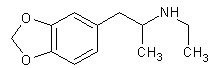 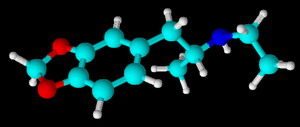 Vorkommen/Verwendung: Kristallines Pulver. Aufnahme: Einzeldosis: 100-200 mg. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Zum Screening werden Immunoassays verwendet, zur quantitativen Bestätigung (meist im Blut) GC/MS. Nachweisbarkeit * Im Blut bis 1 Tag, * Im Urin bis ca. 3 d Die GTFCh (2009) gibt folgende Nachweisgrenzen für forensische Erfordernisse an (die Serum/Plasma-Werte erfüllen die Vorgaben der Grenzwertkommission bzgl. § 24a (2) StVG): MDEA --> 25 ng/ml (Serum/Plasma), 200 ng/ml (Urin), 0,1 ng/mg (Haare) Bewertung: MDE ist ein berauschendes Mittel im Sinnes der Anlage zum §24a StVG (Empfehlung der Grenzwertkommission: 25 ng/ml). MDE ist Bestandteil der Anlage I des Betäubungsmittelgesetzes (nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: Die Metabolisierung des MDE wird analog zum MDMA durch N-Dealkylierung oder durch Öffnung des Dioxol-Ringes (primärer Abbauweg) eingeleitet; die verschiedenen Bruchstücke (z.B. Dihydroxyamphetamin) werden glucuronidiert. Die Metabolisierungs-Route verläuft u.a. über das MDA (3 %) und kann in Teilen mit der des Amphetamins und des MDMA zusammenfallen. MDE wird zu ca. 20 % unmetabolisiert ausgeschieden. Nachweisbare Metaboliten sind z.B.: 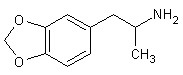 MDA MDA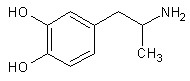 3,4-Dihydroxyamphetamin 3,4-DihydroxyamphetaminWirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkdauer: 3-6 h. Symptome: Artikulationsstörungen, erweiterte Pupillen, Augenzittern und Lichtempfindlichkeit. Mundtrockenheit, gesteigerte Atemfrequenz, erhöhte Körpertemperatur, Brechreiz und Schwindel. Schweißausbrüche, Harndrang. Zittern der Kiefer-Muskulatur und Zähneknirschen. Wirkungsweise: MDE zählt wie MDMA zur Wirkstoffgruppe der Entaktogene, wobei es stark entaktogen sowie schwach empathogen und halluzinogen wirkt. MDE ist somit weniger „kommunikativ“ als MDMA, verstärkt aber die „Einsichtsfähigkeit“ in die eigene Psyche. In der Gesamtbetrachtung ist MDE weniger Potent als MDMA. Durch MDE wird die optische und akustische Wahrnehmung intensiviert. Trance-ähnliche Zustände sind möglich. MDE wirkt dehydrierend, bei gleichzeitiger Steigerung des Grundumsatzes. Unkontrollierte Einnahme kann somit zu einer völligen Entkräftung, Dehydrierung und Überhitzung führen: Dem Körper werden Nährstoffe durch erhöhte Aktivität entzogen, ohne daß ein Bedürfnis entsteht, diese Nährstoffe nachzuführen. Der Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalt entgleist und plötzlicher Zusammenbruch kann die Folge sein. Stärkeres Potential für psychische Abhängigkeit als bei MDMA. Akute Toxizität: LD50 (Maus, intraperitoneal) = 102 mg/kg Chronische Toxizität: Die ausgeprägte entaktogene Wirkung führt zu starker Ich-Bezogenheit, Teilnahmslosigkeit und zum Verlust sozialer Kontakte. Im Tierversuch sind degenerative Erscheinungen im Zentralnervensystem beobachtbar. Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 11.12.2016, 12:32 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 08.11.2007, 22:05 08.11.2007, 22:05
Beitrag
#21
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Methylphenidat
CAS-Nr.: 113-45-1 RTECS-Nr.: TM3675000 Synonyme: 2-Phenyl-2-(2-piperidyl)ethansäuremethylester, Methyl((RS;RS)(phenyl)(2-piperidyl)acetat). MPH. Dexmethylphenidat ist die enantiomerenreine Form Methyl((R,R)(phenyl)(2-piperidyl)acetat). Ritalin, Medikinet, Concerta, Equasym, Daytrana. Chemische Gruppe: Amphetamin-Derivate Strukturformel und Stäbchenmodell: 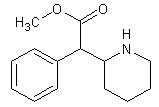 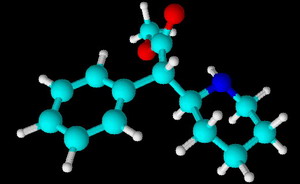 Vorkommen/Verwendung: Oftmals in Form des Hydrochlorids (z.B. Ritalin) Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Hyperkinetische Verhaltensstörungen bei Kindern unter medizinischer Aufsicht und kombiniert mit psychologischen, erzieherischen und sozialen Therapien; Behandlung von Narkolepsie. Aufnahme: Oral als Pille oder transdermal als Pflaster, häufig in Form des Hydrochlorids (Salz des basischen Amins mit der Salzsäure). Therapeutische Dosen müssen individuell durch sorgfältige, ggf. wiederholte Einstellung des Patienten gefunden werden und bewegen sich in der Größenordnung von 2-60 mg/d, durchschnittlich etwa 20-30 mg/d, verteilt auf 2-3 Einzeldosen oder unter Verwendung von Retard-Präparaten. Von der oral applizierten Menge werden ca. 11-51 % resorbiert. Missbräuchliche Aufnahme auch durch Schnupfen oder intravenöse Injektion in deutlich höheren Dosen, bishin zur mehrfachen medizinischen Dosis; während bei streng kontrollierter medizinischer Verabreichung Nebenwirkungen in Grenzen gehalten werden können, sind insbesondere die schweren Nebenwirkungen durch die missbräuchliche Dosiserhöhung besonders gefährdend. Aufgrund des Preises und der geringen Rauscherzeugenden Wirkung hat Ritalin in der Drogenszene eher geringe Bedeutung und wird eher in Selbstmedikation zur ADHS-Behandlung oder Steigerung der Lernfähigkeit missbraucht. Bei Missbrauch zur Rauscherlangung sind erhebliche Überdosierungen notwendig, durch die zusätzlich die Gefahr von Embolien entsteht. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Methylphenidat kann bei Immunoassay-Sceenings falsch-positive Ergebnisse auf Amphetamine liefern. Bei massenspektroskopischer Identifizierung ist Methylphenidat aber leicht von anderen Amphetamin-Derivaten zu unterscheiden. Bewertung: Methylphenidat (und Dexmethylphenidat) ist Bestandteil der Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: Nach oraler Applikation wird die maximale Wirkstoffkonzentration im Blut nach ca. 2 h erreicht, wobei individuelle Faktoren die Pharmakokinetik beeinflussen. Eine direkte Ursachen-Wirkungs-Beziehung zwischen der maximalen Plasmakonzentration und dem pharmakologischen Effekt besteht allerdings nicht. Obwohl Ritalin auch die Amphetamin-Leitstruktur enthält, erfolgt die Metabolisierung anscheinend nicht über das Amphetamin oder seine Abbauprodukte als Zwischenstufe. Die Metabolisierung erfolgt einleitend und rasch über eine Ester-Spaltung zur α-Phenyl-2-Piperidinessigsäure („Ritalinsäure“), deren maximale Blutkonzentration ebenfalls ca. 2 h nach Applikation erreicht wird und die etwa den 30-50fachen Wert des unmetabolisierten Wirkstoffes beträgt („First-Pass-Effect“, d.h. der Wirkstoff wird nach der Resorption aus dem Darm schon bei der ersten Leberpassage zum großen Teil metabolisiert). Bei einer mittleren Halbwertszeit von 2 h wird Methylphenidat innerhalb von 48-96 h zu 78-97 % eliminiert, wobei weniger als 1 % unverändert und ca. 60-86 % als Ritalinsäure im Urin nachweisbar sind. Offenbar wird die bei der Amphetamin-Route übliche Hydroxylierung am phenylsubstituierten Kohlenstoff durch die Carbonsäuregruppe verhindert; hydroxylierte Metaboliten, wie z.B. das Hydroxymethylphenidat, sind nur in geringen Mengen nachweisbar. Gleichzeitg eröffnet die Carbonsäurefunktion einen anderen Metabolisierungsweg. Die Integration des peripheren Stickstoffs in einen Carbocyclus wird ebenfalls dazu beitragen, Ritalinmetabolite von denen des Amphetamins unterscheidbar zu machen. Wirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkeintritt ca. 15-30 min nach oraler Applikation; medizinische Wirkung über einen Zeitraum von 3-4 h. Symptome: Konzentrationsmängel, Geräuschempfindlichkeit, Nervosität, Tremor, Schläfrigkeit aber auch Schlaflosigkeit; übermäßige Transpiration, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen Übelkeit und Erbrechen (z.B. bei Therapie-Begin); mitunter Akkomodationsstörungen und verschwommenes Sehen. Mundtrockenheit bishin zu Mundschleimhautentzündungen. Schmerzen in der Brust, Benommenheit, Kopfschmerzen, Schwindel, Verwirrtheit Allergische Hautausschläge und Haarausfall sind möglich, ebenso Durchfall und Blasenentleerungsstörungen. Wirkungen: Methylphenidat ist ein Stimulanz für das Zentralnervensystem und wirkt sich auf die mentalen und motorischen Aktivitäten aus. Ähnlich anderen Wirkstoffen aus der Amphetamin-Reihe sind Erhöhung des Blutdrucks, Herzklopfen bishin zu Herzrhythmusstörungen und Herzinfarkten, Muskelzuckungen und –Krämpfen bei Überdosierung kennzeichnend. Bei psychotischen Konsumenten können Verhaltens- und Denkstörungen verstärkt werden. Das Risiko epileptischer Anfälle bei prädisponierten Konsumenten steigt. In erhöhter Dosierung sind euphorische Zustände möglich; Halluzinationen können auftreten. Bei der ADHS-Behandlung kann nach Wirkungsende erhöhte Hyperaktivität auftreten („Rebound“). Methylphenidat ist suchterzeugend bei erheblicher Überdosierung. Chronischer Missbrauch kann zu psychischer Abhängigkeit mit ausgeprägter Gewöhnung führen. Psychotische Episoden sind möglich. Akute Toxizität: LD50 (Ratte, oral) = 430 mg/kg. LD50 (Maus, oral) = 150 mg/kg. Chronische Toxizität: Leber- und Gelenkentzündungen. Leberfunktionsstörungen bishin zu hepatischem Koma. Seelische Überempfindlichkeit, Aggressivität, Angststörungen, Verfolgungswahn, Depressionen und Psychosen. Untersuchungen auf Carcinogenität, Mutagenität und Reprotoxizität am Tier lieferten bei erheblicher Überdosierung uneindeutige Ergebnisse. Bei therapeutischen Dosen konnten derartige Wirkungen nicht sicher belegt werden. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 11.11.2007, 18:29 11.11.2007, 18:29
Beitrag
#22
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Kokain
CAS-Nr.: 50-36-2, 53-21-4 Synonyme: Benzoylecgonin-methylester, Methyl(3ß-(benzoyloxy)tropan-2ß-carboxylat), (2R,3S)-3-Benzoyloxy-tropan-2-carbonsäure-methylester, 3-Benzoyloxy-8-methylazabicyclo[3.2.1]octan-2-carbonsäuremethylester. d-Kokain ist das Isomer Methyl(3ß-(benzoyloxy)tropan-2α-carboxylat). Cocain, Crack, Koks, Schnee, Dust Croak ist die Mischung aus Kokain und Methamphetamine. Chemische Gruppe: Tropan-Alkaloide; Ecgonin-Derivat. Strukturformel und Stäbchenmodell: 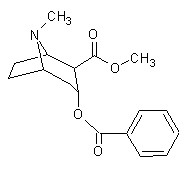 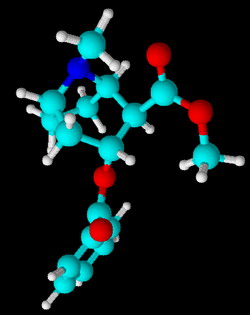 Vorkommen/Verwendung: Farbloser Feststoff, der aus den Blättern des Kokastrauchs extrahiert wird. Verwendung häufig in Form des Hydrochlorids (i.e. das Salz des Amins und Salzsäure; der Amin-Stickstoff wird zum Ammonium-Ion protoniert und das Chlorid bildet das Gegenion). Das unprotonierte Amin wird auch als „freie Base“ oder „free base“ bezeichnet. Beim Kokainsulfat wird analog formal nicht Salzsäure, sondern Schwefelsäure als „Säurekomponente“ verwendet. In der Praxis ist im Rahmen der Wirkstoffextraktion aus den Koka-Blättern das Sulfat ein Vorprodukt zum Hydrochlorid. Crack wird durch Behandlung des Hydrochlorids mit Natriumhydrogencarbonat hergestellt, wobei das Amin wieder deprotoniert wird. Die entstehende Wirkstoff/Salzmischung setzt bei Erwärmung CO2 und den Wirkstoff wieder frei; das Kokain wird rauchbar. Illegales Kokain wird im Allgemeinen gestreckt in Umlauf gebracht, mitunter auch Beimengungen von Amphetaminderivaten (Amphetamin, MDMA, Ephedrin) enthaltend. Der Reinheitsgrad variiert stark, was wiederum das Risiko einer Überdosierung erhöht, sofern der Konsument gestreckten Stoff gewöhnt ist und unerwartet reineres Kokain erhält. Gelegentliche medizinische Verwendung als lokales Anästhetikum bei Augenoperationen, wird aber wegen der unerwünschten Nebenwirkungen und der suchterzeugenden Wirkungen kaum noch verwendet. Missbrauch als leistungssteigernde und rauscherzeugende Droge. Aufnahme: Schnupfen als Kokain-Hydrochlorid; Dosis ca. 10-25 mg (uneinheitliche Literaturangaben für Bioverfügbarkeit: 10-30 % (wahrscheinlich im Allgemeinen zutreffend) bzw. 25-80 % der Applikationsdosis gelangt in die Blutbahn), bei Gewöhnung mehr (> 100 mg). Rauchen der freien Base oder Crack; Dosis ca. 250-1000 mg (i.d.R. 6-32 %, max. 57 % bioverfügbar). Intravenöse Injektion der zuvor aufgelösten Substanz; 10-20 mg, bei intensivem Missbrauch bis zu 50 mg. Orale Aufnahme durch Kauen von Koka-Blättern (eher geringe Dosis; 20-30 % des enthaltenen Wirkstoffes sind bioverfügbar). Auch orale Applikation von Kokain-Hydrochlorid; Dosis ca. 100-200 mg. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Der Kokain-Nachweis ist möglich in Blut, Urin, Speichel und Haaren; zum Screeing: Immunoassay verwendet, zur quantitativen Bestätigung GC/MS, in der Regel über den Metaboliten Benzoylecgonin. Der Kokain-Gehalt kann durch Zersetzung selbst in gekühlten Blutproben weiter abnehmen. Es wird berichtet, daß auch in einer Venüle mit einem Zusatz von NaF und K2Ox bei 4 °C innerhalb eines Monats die Kokain-Konzentration von 186 ng/ml auf 109 ng/ml sank. [Baselt RC, Yoshikawa D, Chang J, Li J. Improved long-term stability of blood cocaine in evacuated collection tubes. J Forensic Sci 1993;38:935-937.] Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für den Metaboliten Benzoylecgonin: 50-300 ng/ml Nachweisbarkeit: * im Urin: 2 – 4 Tage mitunter bis 6 Tage, i.d.R. über Metaboliten. * im Blut: ca. 1 Tag Die GTFCh (2009) gibt folgende Nachweisgrenzen für forensische Erfordernisse an (die Serum/Plasma-Werte erfüllen die Vorgaben der Grenzwertkommission bzgl. § 24a (2) StVG): Kokain --> 10 ng/ml (Serum/Plasma), 0,1 ng/mg (Haare) Benzoylecgonin --> 30 ng/ml (Serum/Plasma), 30 ng/ml (Urin) 0,1 ng/mg (Haare) Langzeitnachweis über Haaranalyse: 0,50-0,10 ng Kokain /mg Haar bzw. 0,1 ng Benzoylecgonin / mg Haar gelten als positiv. Einzeldosen von 0,6 mg/kg Körpergewicht sind nachweisbar. Werte von 50 ng/mg deuten auf Drogenabhängigkeit, bei Konsum von mehreren Gramm Kokain pro Tag können Werte von 200 ng/mg erreicht werden, von einem Extremfall mit 300 ng/mg wurde berichtet. Exemplarischer Cut-Off für Urin: 30 ng/ml Die Nachweiszeiten der Metaboliten verlängern sich bei Mischkonsum mit Alkohol. Bewertung: Kokain in Form nachgewiesenen Benzoylecgonins ist ein berauschendes Mittel im Sinnes der Anlage zum §24a StVG (Empfehlung der Grenzwertkommission: 10 ng/ml für Kokain, 75 ng/ml für den Metaboliten Benzoylecgonin). d-Kokain (Methyl(3ß-(benzoyloxy)tropan-2alpha-carboxylat)) ist Bestandteil der Anlage II des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige, aber nicht verschreibungsfähige Betäubungsmittel). Kokain ist Bestandteil der Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: Der zeitliche Verlauf der Blutkonzentration ist stark abhängig von der Applikationsform: Während bei Inhalation der Wirkstoff durch die Lunge sehr schnell ins Blut übergeht, wird bei nasaler Applikation das Konzentrationsmaximum nach 30-60 min erreicht, bleibt dann aber längere Zeit auf hohem Niveau. Die Metabolisierung wird durch zweistufige Esterverseifung zum Ecgonin eingeleitet. 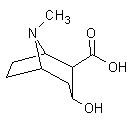 Die Abbauprodukte von Kokain werden durch Urin und Schweiß ausgeschieden und lagern sich nicht in dem Maße in Zellen ein wie bsp. bei THC; dessen ungeachtet ist Kokain durch Haaranalyse einfach und lange nachweisbar: Bei intensivem Konsum werden noch zwei Monate nach Abstinenzbeginn (sic!) nachweisbare Kokain-Spuren aus Gewebe-Reserven in das Haar eingelagert. Das beim Mischkonsum mit Alkohol in der Leber gebildete Coca-Ethylen wird langsamer abgebaut als Kokain selbst; die Metaboliten sind deshalb länger nachweisbar. Wirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkung und Wirkdauer sind beim Kokain ausgesprochen abhängig von der Applikationsform. Die angegebenen Wirkdauern beziehen sich auf die Dauer der euphorischen, ersten Phase der Wirkung. Die anschließenden dysphorischen und depressiven Phasen können sich über längere Zeiträume erstrecken. Nasale Applikation: Wirkeintritt nach 1-3 min für 25-90 min Wirkdauer. Inhalative Applikation der freien Base oder der Koka-Paste: Wirkeintritt nach 5-10 s für 2-10 min Wirkdauer („Flash“). Intravenöse Applikation: Wirkeintritt nach ca. 30-45 s. Wirkhöhepunkt für 5-20 Minuten; Nachwirkungen (insbesondere die negativen Wirkungen) lange über diesen Zeitraum hinaus. Orale Applikation von Kokain-Hydrochlorid: Wirkeintritt nach 10-30 min, Wirkdauer bis zu 2 h. Symptome: Redseligkeit, erweiterte Pupillen, Schwitzen, motorische Unruhe, Händezittern, Erregung, Puls- und Blutdruckzunahme („Tachykardie“ und „Hypertonus“), Koordinationsstörungen, erhöhte Körpertemperatur („Hyperthermie“; kann bei Überdosierung lebensbedrohende Ausmaße annehmen), mit Schüttelfrost abwechselnd; laufende Nase („Kokain-Schnupfen“), ggf. Nasenbluten, Kopfschmerzen. Erhöhte Puls- und Atemfrequenz, unregelmäßige Atmung, Übelkeit und Erbrechen. Blutdrucksteigerung durch Verengung der Blutgefäße; Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle mit Blockierung der Atmung. Bei Crack-Rauchern Brustschmerzen und schwarzer Auswurf. Laktatazidose. Wirkung: Kokain ist eine Droge, die das Zentralnervensystem stimuliert: Der Beginn des Kokain-Rausches zeichnet sich durch ein euphorisches Stadium mit stärkerer Wachheit, Sinneswahrnehmung, Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Denkaktivität sowie erhöhtem Antrieb und Selbstwertgefühl aus; Hemmungen jeglicher Art sowie Ängste werden abgebaut und die Impulskontrolle vermindert, was zu gesteigerter Aggressivität führen kann. Hunger- und Müdigkeitsgefühle werden unterdrückt. Der Konsument fühlt sich mental, physisch und moralisch anderen Menschen überlegen. Obwohl die Wirkung nur relativ kurze Zeit andauert, ist es dennoch diese extreme Euphorie, die zu erneutem Konsum reizt. Allmählich klingt die Euphorie ab und kann durch eine paranoide, ängstliche Stimmungslage mit akustischen und optischen Halluzinationen abgelöst werden (Dysphorie). In der finalen Phase schlägt die Wirkung vollends um: Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Erschöpfung bis hin zu Angstzuständen, Schuldgefühlen, Selbstvorwürfen und Suizidgedanken kennzeichnen diese langanhaltende, depressive Phase. Die Symptomatik des Kokain-Mißbrauchs wurde schon durch Sir Arthur Conan Doyle trefflich beschrieben. Die Ausprägung der Rauschphasen ist abhängig von der Applikationsform: Während Schnupfen als angenehmer, länger anhaltender Rausch empfunden wird, erzeugt Rauchen einen eher kurzen, aber ausgesprochen starken Kick. Fahrunsicherheit ist in allen Phasen des Rausches gegeben: In der euphorischen Phase durch Enthemmung und erhöhte Risikobereitschaft, in der dysphorischen und depressiven Phase durch Blendempfindlichkeit (geweitete Pupillen), Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen sowie halluzinatorische Beeinträchtigungen bishin zu suizidalen Reaktionen. Kokain erzeugt starke psychische Abhängigkeit, hervorgerufen durch die starke Steigerung des Selbstwertgefühls in der primären Phase und der darauf folgenden Depression. Schon einmaliger Konsum kann insofern dazu führen, die Depression durch erneuten Konsum und der dadurch induzierten Euphorie zu vertreiben. Akute Toxizität: Die akute Toxizität ist sehr stark von individuellen Faktoren und der Konsumform abhängig: Durch häufigen Konsum können Toleranzen bis zu mehreren Gramm aufgebaut werden, wohingegen im Allgemeinen schon 0,5-2 g (oder bei empfindlichen Personen auch weniger) als tödliche Dosis angesehen werden. Die Gefahr einer Überdosierung ist allgemein, insbesondere aber beim Rauchen von Crack sehr hoch, weil meist der Grad der Verunreinigung bzw. der Streckung nicht bekannt ist. Kritisch ist u.a. die Belastung des Herz-Kreislaufsystems. Je nach Dosierung kann es zum Platzen von Blutgefäßen (Hirnblutungen oder Aortendissektion) oder zum Herzinfarkt kommen. Myokardinfarkte sind offenbar auch noch bis zu zwei Wochen nach dem letzten Kokain-Mißbrauch beschrieben. Erhöhtes Thrombose-Risiko durch Verengung der Blutgefäße und erhöhte Thrombozytenaggregation. Lungenödeme sind bei Kokain-Intoxikationen möglich. Bei schweren Intoxikationen kann eine Atemlähmung eintreten, die oftmals tödlich verläuft. LD50 (Maus) = 96 mg/kg Schwangerschaften werden durch Kokain-Konsum gefährdet: Aufgrund der Gefäßverengungen und der Blutdrucksteigerung drohen Früh- und Fehlgeburten sowie eine Sauerstoffunterversorgung des Fötus. Entwicklungsstörungen und Schädigungen der Leibesfrucht sind möglich (Hirnfehlbildungen, Missbildungen, Funktionsstörungen innerer Organe). Die Gefahr einer tödlichen Überdosierung steigt signifikant durch Mischkonsum mit anderen Drogen oder Betäubungsmitteln (bsp. Lidocain). Durch Alkohol wird die Kokain-Wirkung deutlich verstärkt. Insbesondere sie Umesterung des Benzoylecgonin-methylester zum stärker organtoxischen Ethylester (d.h. formal wird der Methyl-Rest als Methanol abgespalten und der Ethylrest aus dem Ethanol in die Kokain-Molekülstruktur aufgenommen; auch „Cocaethylen“ genannt) stellt physiologisch eine besondere Gefahr dar. Über die physiologische Wirkung hinaus führt der Alkohol/Kokain-Mischkonsum häufig zu einer emotionalen Verhärtung und zu einem Ego-Trip, der von Mitmenschen als asozial empfunden wird. Eine phänomenologisch ähnliche synergistische Wirkung ist auch bei Mischkonsum mit Cannabis beobachtbar: Die Kokain-Blutkonzentration bleibt länger auf einem höherem Level; der euphorische Rauschzustand wird länger und intensiver wahrgenommen, allerdings wird auch die organtoxische Wirkung gesteigert. Besonders kritisch ist der Mischkonsum mit weiteren blutdrucksteigernden Mitteln. Durch die kombinierte Wirkung kann es schnell zu Herz- und Hirninfarkten kommen; auch bei geringen Dosen stellt dieser Mischkonsum zumindest eine schwere Belastung für das Herz-Kreislaufsystem dar. Beispielhaft für blutdrucksteigernde Mittel ist das Amphetamin und seine Derivate zu nennen. Chronische Toxizität: Bei chronischen Kokain-Rauchern werden Schleimhäute, Lippen, die Mundhöhle und die Bronchien geschädigt. Bei kontinuierlichen Schnupfern kommt es zur Schädigung der Nasenschleimhäute bishin zur Perforation der Nasenscheidewand. Die Riechfähigkeit wird temporär – in schweren Fällen irreversibel - geschädigt oder sogar zerstört. Aufgrund der Wirkungen auf das Herzkreislauf-System und der Organ- und Nerventoxizität kann es bei chronischem Konsum zu Schäden am Herzkreislauf-System sowie Leber- und Nierenschäden kommen, sowie zu Zittern und Krampfanfällen kommen. Wahrnehmungsstörungen können dauerhaft eintreten. Kribbeln unter der Haut („Insektenlaufen“) ist charakteristisch. Kokain unterdrückt das Hunger- und Durstgefühl sowie das Schlafbedürfnis. Bei längerem Mißbrauch kommt es im Allgemeinen zu Konzentrationsstörungen; wegen der chronischen Appetitlosigkeit treten Mangelerscheinungen und Gewichtsverlust ein. Nervosität, Aggresivität und erhöhte Gewaltbereitschaft, Störungen des logischen Denkens, zeitliche und örtliche Desorientierung, Verfolgungswahn und paranoid-halluzinatorische Psychosen sind möglich, wobei Erlebnisse paranoid umgeformt werden und eine Kokainabhängigkeit geleugnet wird. In der euphorischen Phase wird das Selbstwertgefühl enorm übersteigert. Bei chronischem Konsum kann dies zu signifikanter Egozentrik mit fehlender Selbstkritik führen; der Konsument fühlt sich über die Regeln der Gesellschaft erhaben (Unterdrückung des Gewissens) und verlernt normales Sozialverhalten. Dauerkokser verhalten sich oftmals aggressiv, arrogant und unsensibel („Ego-Droge“; beim Crack-Rauchen charakteristisch noch ausgeprägter als bei anderen Konsum-Formen). Durch die depressiven Stadien nach einem Konsum kommt es zum Bedürfnis nach sofortigem weiteren Konsum. Einerseits begründet dies die enorme suchterzeugende Wirkung des Kokains; andererseits liegt hier die Ursache für das charakteristische Konsummuster, bei dem über Stunden oder Tage intensiv und in kurzen Abständen Kokain konsumiert wird. Neben diesen psychischen Suchtfaktoren entwickelt sich bei chronischem Konsum Toleranz gegenüber der psychotropen Wirkung, bei der u.a. die euphorisierende Wirkdauer verkürzt wird; als Folge entsteht eine Tendenz zur Dosiserhöhung. Dahingegen bildet sich die Toleranz gegenüber den physiologischen Wirkungen geringer aus; als Folge nähert sich die konsumierte Wirkdosis der akut toxischen Dosis immer mehr an. Neurokognitive Störungen wie verringerte Lernfähigkeit, verschlechtertes Gedächtnis und Aufmerksamkeitssörungen können eintreten. Solche Störungen können irreversibel sein. Chronische Herzrhythmusstörungen können entstehen. Impotenz und Unfruchtbarkeit können eintreten. Intravenöser Konsum geht oftmals einher mit körperlicher und sozialer Verwahrlosung Entzugserscheinungen: Dysphorie, Schlaflosigkeit, lebhafte und unangenehme Träume; Mattigkeit, Lustlosigkeit. Depressionen, Halluzinationen und Psychosen mit Suizidideen. Diese Symptome könenn über einen Zeitraum von bis zu zehn Wochen anhalten. Enorme Gefahr von Rückfällen aufgrund von Schlüsselreizen. Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 11.12.2016, 12:25
Bearbeitungsgrund: Empfehlung der Grenzwertkommission eingefügt.
-------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 12.11.2007, 20:21 12.11.2007, 20:21
Beitrag
#23
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Benzodiazepin
Synonyme: 3H-1,4-Benzo[f]diazepin Chemische Gruppe: Benzodiazepine Strukturformel und Stäbchenmodell: 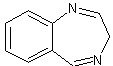 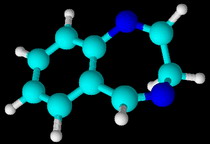 Vorkommen/Verwendung: Stammverbindung der 1,4-Benzodiazepine, einer Reihe von Tranqilizern, Schlafmitteln und Antiepileptika, die im Wesentlichen angstlösend, antikonvulsiv, muskelrelaxierend und sedierend wirken. Während die unsubstituierte Stammverbindung medizinisch bedeutungslos ist (dies gilt nicht nur für das abgebildete 3H-Tautomer, sondern auch für andere tautomere Formen wie das stabilere 1H-Tautomer), eröffnet die substituierte Leitstruktur dem Chemiker und dem Pharmakologen eine fruchtbare Spielwiese: Durch exocyclische Seitenketten bishin zu weiteren, anellierten Ringsystemen läßt sich die Lipohilie – und damit die Pharmakohinetik – steuern; gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, die Passgenauigkeit zum Benzodiazepin-empfindlichen Rezeptor in den Nervenzellen, dem GABA-Rezeptor – durch strukturelle Modifizierungen zu verändern. Unter Ausnutzung der allgemein für diese Wirkstoffklasse sehr ähnlichen Metabolisierungsrouten mit pharmakologisch selbst wirksamen Metaboliten läßt sich sogar die Verweilzeit von Wirkstoffen mit Benzodiazepin-typischem Wirkspektrum im Körper vortrefflich steuern. So finden auch tatsächlich zahlreiche Derivate pharmakologischen Einsatz. Dies hat zur Folge, daß trotz des nahezu identischen Wirk- und Nebenwirkungsspektrums der großen Zahl von Benzodiazepin-Derivaten die Intensität und Dauer der Wirkung sehr unterschiedlich sein kann. Benzodiazepine werden üblicherweise in lang- mittel- und kurzwirksame Wirkstoffe eingeteilt. Dies hat natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die Ausscheidungsraten der Stoffe aus dem menschlichen Körper und auf die Zeiträume, in denen Benzodiazepin-Konsum nachgewiesen werden kann. Einige Beispiele für Medikamentennamen sind das Diazepam, Oxazepam, Bromazepam, Lorazepam oder Chlordiazepoxid. Eine Abwandlung der Leitstruktur findet sich in Form des 1,5-Benzodiazepins (i.e. geänderte Stellung der intracyclischen Stickstoff-Atome) z.B. als Clobazam. In Abhängigkeit von der Substitution lassen sich hoch potente Wirkstoffe mit nuancierter Wirkung synthetisieren, die Aufgrund der Metabolisierung unterschiedliche Verweilzeiten im Körper und damit auch abgestufte Wirkdauer aufweisen. Oftmals werden dabei Metaboliten gebildet, die selbst wiederum mehr oder weniger dauerhaft pharmakologisch wirksam sind, und z.T. auch als eigenständige Arzneimittel verabreicht werden. Missbrauch wird einerseits betrieben in Form von Selbstmedikation bei psychischem Stress und Angstzuständen; die sedierene Wirkung wird häufig als angenehm empfunden, weil die Probleme des Alltags in den Hintergrund rücken und eine angenehme Müdigkeit und Schlaf den Konsumenten umhüllt. Andererseits werden Benzodiazepine genommen, um die Wirkungen aufputschender Drogen wie Amphetaminen oder Kokain zu dämpfen und wieder „herunterzukommen“. Ein weiteres missbräuchliches Einsatzgebiet ist die Substitution anderer Drogen in Selbstmedikation. Weiterhin werden Benzodiazepine missbraucht, um in Überdosierung rauschartige Zustände zu erreichen. Eine besondere Gefahr für Nichtkonsumenten ist der kriminelle Einsatz zur Betäubung und Willenlos-Setzung der Opfer durch heimliche Applikation, z.B. im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen. Der missbräuchliche Einsatz der Benzodiazepine ist ferner charakteristisch in Form des Beikonsums z.B. bei Opiat-Abhängigen:
Problematisch ist der Einsatz der hochwirksamen Bezodiazepine hauptsächlich einerseits wegen des starken Potenzials zur Erzeugung psychischer und physischer Abhängigkeit, die bei plötzlicher Abstinenz nach längerem Konsum – aber mitunter auch schon nach kurzer Applikationsdauer – zu heftigsten Entzugserscheinungen führt. Um solche – mitunter tödlichen – Folgen des Benzodiazepin-Entzugs zu minimieren, ist die Medikation ggf. unter ärztlicher Überwachung über einen mehrwöchigen Zeitraum „auszuschleichen“, d.h. langsam und kontrolliert auf Null zu fahren. Andererseits ist das Spektrum der Nebenwirkungen beträchtlich, das bei Mischkonsum mit anderen Wirkstoffen durch gegenseitige Wechselwirkungen schnell lebensbedrohliche Ausmaße annehmen kann. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 14.11.2007, 20:18 14.11.2007, 20:18
Beitrag
#24
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Diazepam
CAS-Nr.: 439-14-5 RTECS-Nr.: DF1575000 Synonyme: 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on. Methyldiazepinon Valium, Faustan, Valocordin, Psychopax, Diazeplex, Relanium Chemische Gruppe: Benzodiazepine Strukturformel und Stäbchenmodell: 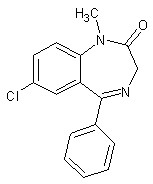 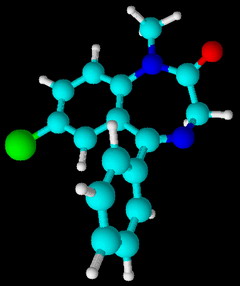 Vorkommen/Verwendung: Farbloser oder gelblicher Feststoff. Medizinische Verwendung als langzeitwirkendes Psychopharmakon und Beruhigungs- bzw. Schlafmittel, bsp. zur Behandlung von akuten Erregungs- und Angstzuständen. Muskelrelaxans, Sedativum und Antikonvulsivum, z.B. zur Therapie bei epileptischen Anfällen oder für präoperative Zwecke (chirurgische Eingriffe, invasive Diagnostik, Zahnbehandlungen). Einsatz zur Dämpfung von Entzugserscheinungen nach Absetzung des Konsums anderer ZNS-depressiver Wirkstoffe. Symptomatische Therapie von Intoxikationen ZNS-stimulierender Wirkstoffe, z.B. nach Amphetamin- oder Kokain-Mißbrauch, oder anderer Giftstoffe wie Sarin, VX, Soman oder Pestiziden auf Organophosphat-Basis. Missbrauch als Lifestyle-Droge oder nach dem Konsum von Aufputschmitteln zum „herunterkommen“ oder zum Lindern der depressiven Symptome (z.B. Kokain, Amphetamine). Aufnahme: Medizinischer Einsatz in oraler oder rektaler Form; Injektionen in zeitlich gestaffelten, kleinen Dosen, bis der gewünschte Effekt bzw. die vertretbare Maximaldosis erreicht ist. Bei Kindern sind die Maximaldosen geringer. Als Anxiolytikum: Tagesdosis bis zu 30 mg, verteilt auf 2-3 Einzeldosen. Als Hypnotikum: Bis zu 30 mg als Einzeldosis. Operative Prämedikation: Bis zu 20 mg als Einzeldosis. Behandlung epileptischer Zustände: Maximal 40-60 mg. Es existieren Hinweise auf Hautresorption. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für Benzodiazapine: 100-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Blut-/Serumanalytik: 15-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Urin: 50 ng/ml Nachweiszeit im Urin: 3 Tage bei therapeutischer Dosis, bis zu 4-6 Wochen bei Langzeiteinnahme Haaranalyse empfindlich gegen Bleichen Analysen im pg/mg-Bereich; Routine-Haaranalyse Cut-Off = 0,05 ng/mg. Schnelltests gestört durch: ß-Blocker Neuroleptika Bewertung: Diazepam ist Bestandteil der Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: Diazepam wird nach oraler Applikation nahezu vollständig resorbiert (Bioverfügbarkeit nahezu 100 %); die maximale Wirkstoffkonzentration wird durchschnittlich innerhalb einer Stunde erreicht, wobei die Schwankungsbreite groß ist. Bei intravenöser Applikation werden nach ca. 15 Minuten Blutkonzentrationen von 400 ng/ml (10 mg appliziert) bzw. 1200 ng/ml (20 mg appliziert) berichtet. Chronische Applikation von 2-30 mg/d resultiert in Blutkonzentrationen von 20-1010 ng/ml Diazepam und 55-1765 ng/ml N-desalkyliertem Metaboliten. Der therapeutische Blutspiegel liegt bei etwa 200-2000 ng/ml. Diazepam ist sehr gut fettlöslich; die Kinetik lässt sich durch ein Zweikompartimenten-Modell beschreiben, bei dem unmittelbar nach der Applikation Wirkstoff in das Gewebe einwandert und so einen schnellen Abfall der Blutkonzentration verursacht; aus dem Gewebe-Speicher wird der Wirkstoff dagegen relativ langsam wieder freigesetzt, sodaß in der zweiten Phase die Eliminierungsgeschwindigkeit deutlich geringer ist. Die Metabolisierung erfolgt primär in der Leber und wird eingeleitet durch N-Demethylierung oder Hydroxylierung in 3-Stellung. Entsprechend wird entweder über die Temazepam- oder die Nordiazepam-Route das Oxazepam gebildet. 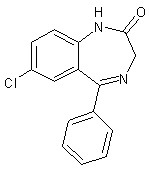 Nordiazepam Nordiazepam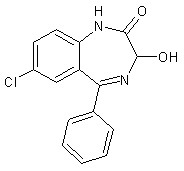 Oxazepam OxazepamDas Oxazepam schließlich kann glucuronidiert oder sulphatiert werden. Im Blut ist hauptsächlich das Diazepam und das Nordiazepam nachweisbar, weil das Temazepam und das Oxazepam in etwa genau so schnell eliminiert werden, wie sie gebildet werden. Altersabhängige Halbwertszeit von ca. 24-48 h, bei älteren oder lebergeschädigten Menschen auch deutlich länger. Die Metaboliten sind selbst pharmakologisch wirksam und weisen Halbwertszeiten von 50-80 h auf. Bei chronischer Applikation können sich Wirkstoffpuffer bilden, die bis zu zwei Wochen (sic!) nachweisbar sind. Aufgrund der komplexen Pharmakokinetik besteht, ähnlich wie beim THC, keine einfache Ursachen-Wirkungs-Beziehung zwischen der messbaren Blutkonzentration und der tatsächlichen pharmazeutischen Wirkung. Die Geschwindigkeit des Diazepam-Metabolismus kann durch andere Wirkstoffe in beide Richtungen stark beeinflusst werden. Wirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkeintritt bei oraler Applikation nach ca. 15 min. Wirkeintritt bei Injektion nach ca. 1-3 min für 0,5-3 h Wirkdauer bei 10 mg. Symptome: Seh- und Sprachstörungen (Diplopie, Dysarthrie) sowie Gleichgewichts- und Bewegungsstörungen (Ataxie). Unregelmäßigkeiten bei der Atmung, Atemaussetzer bishin zur Atemlähmung. Benommenheit/Verwirrtheit, Schläfrigkeit und Mattigkeit, starke Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens, Kopfschmerzen, langsamer Puls, Koordinationsstörungen, Angstzustände. Mundtrockenheit aber auch vermehrter Speichelfluß sind möglich, Magen-Darm-Beschwerden, Verstopfung, Gelbsucht, Blasenschwäche. In manchen Fällen wird die Aggressivität gesteigert. Wirkungsweise: Diazepam wirkt dämpfend auf das Zentralnervensystem. Hieraus resultieren neben den oben beschriebenen körperlichen Syptomen auch eine Verringerung der Denkleistung, Gedächtnisstörungen (insbesondere für den Zeitraum unmittelbar vor und nach der Applikation (anterograde Amnesie)) sowie Störung der kognitiven und psychomotorische Fähigkeiten. Das gesamte Herz-Kreislauf-System wird durch Diazepam beeinflusst; Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit und Koma können dosisabhängig eintreten. Überempfindlichkeitsreaktionen und Sexualschwäche sind möglich. Überdosierung kann rauschähnliche Zustände herrufen („Valium-Trips“). Bei Mischkonsum mit Alkohol und vielen anderen Wirkstoffen werden die Diazepam-Wirkungen verstärkt. Akute Toxizität: Überdosierung kann zu Koma und Lungenversagen führen, wenngleich Todesfälle aufgrund Diazepam-Vergiftungen eher selten berichtet werden. Demgegenüber stehen allerdings viele tödliche Mischintoxikationen unter Beteiligung von Diazepam. In einem Fall wurde berichtet, dass ein Mensch nach Applikation von 500 mg in suizidaler Absicht mit Hilfe intensivmedizinischer Betreuung überlebte. LD50(oral, Ratte) = 1200 mg/kg (--> „gesundheitsschädlich“ nach Stoffrecht) Diazepam wirkt fruchtschädigend und kann zu Missbildungen bei ungeborenen Kindern führen, insbesondere bei Einnahme während der ersten drei Schwangerschaftsmonate. Diazepam akkumuliert ferner in der Muttermilch. Chronische Toxizität: Gelbsucht, Leberschäden. Harnverhalt aber auch Inkontinenz. Sehr ernste Gefahr psychischer und physischer Abhängigkeit, auch bei medizinischer, kurzzeitiger Anwendung. Plötzliche Absetzung nach chronischem Konsum führt zu schweren Entzugserscheinungen und Rebound-Effekten; aus diesem Grunde muß Diazepam „ausgeschlichen“ werden, d.h. die Dosis muß unter ärztlicher Kontrolle langsam bis auf Null reduziert werden. Entzugserscheinungen: Entzugserscheinungen beginnen zuerst langsam mit dem Konsumstopp, werden aber nach 5-9 Tagen zunehmend ernster. Sie äußern sich in Kopfschmerzen, Tinnitus, Muskelzittern (Tremor), Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Hypotonie, Überempfindlichkeit gegenüber optischen und akustischen Reizen, Herzrasen, Verwirrtheit, Übelkeit und Erbrechen, erhöhter Temperatur (Hyperthermie), und muskulärern Spasmen. Angstzustände, Psychosen und Halluzinationen sind möglich. Schwere Entzugserscheinungen können zu Anfällen und Tod führen. Die Entzugserscheinungen klingen i.d.R. nach 2-3 Woche ab. Aufgrund der Schwere der Entzugserscheinungen sollte Diazepam nicht schlagartig abgesetzt werden, sondern die Applikation muß unter ärztlicher Aufsicht ggf. über mehrere Wochen vorsichtig bis auf Null reduziert werden („ausschleichen“). -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 18.11.2007, 19:12 18.11.2007, 19:12
Beitrag
#25
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Clorazepat
CAS-Nr.: 23887-31-2, 57109-90-7 RTECS-Nr.: DE8750000 Synonyme: 7-Chlor-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure Tranxilium, Tencilan, Tranxene, Tranxilen, Mendon, Nevracten Chemische Gruppe: Benzodiazepine Strukturformel und Stäbchenmodell: 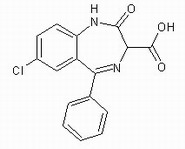 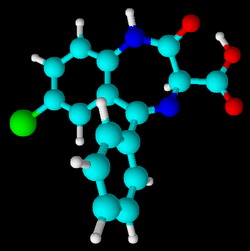 Vorkommen/Verwendung: Fast farbloser oder leicht gelblicher Feststoff; Vorkommen häufig in Form des Kalium-Salzes. Medizinische Verwendung als rasch- und langzeitwirkendes (über den Tag der Applikation hinaus!)) Psychopharmakon und Beruhigungs- bzw. Schlafmittel, z.B. zur Behandlung von Angst- und Panikattacken, u.a. auch während des Barbiturat- oder stationären Alkohol-Entzugs oder für präoperative Zwecke (chirurgische Eingriffe, invasive Diagnostik). Missbrauch nach dem Konsum von Aufputschmitteln zum „herunterkommen“ oder zum Lindern der depressiven Symptome (z.B. Kokain, Amphetamine). Applikation in oraler Form als Pille oder durch Injektion. Aufnahme: Medizinischer Einsatz in oraler Form oder als langsame Injektionen. Üblicherweise Verabreichung von 5-15 mg als Einmal-Tagesdosis oder bis zu 30 mg/d in zwei Einzeldosen. Initiale Stossbehandlungen können Dosen bis 50 mg erfordern. Die maximale Tagesdosis sollte 90 mg nicht überschreiten. Bei stationärer Überwachung sind in Ausnahmefällen Tagesdosen bis 200 mg möglich. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für Benzodiazapine: 100-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Blut-/Serumanalytik: 15-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Urin: 50 ng/ml Nachweiszeit im Urin: 3 Tage bei therapeutischer Dosis (bei langwirkenden Benzodiazepinen, wie dem Clorazepat, eher länger), bis zu 4-6 Wochen bei Langzeiteinnahme. Haaranalyse empfindlich gegen Bleichen; Analysen im pg/mg(Haar)-Bereich. Schnelltests gestört durch: ß-Blocker Neuroleptika Bewertung: Clorazepat ist Bestandteil der Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: Chlorazepat selbst ist nur gering pharmakologisch wirksam. Die besondere Bedeutung liegt aber in der Umwandlung zu pharmakologisch wirksamen Metaboliten, die kontinuierlich so lange nachgebildet werden, bis die ursprüngliche Komponente verbraucht ist (Halbwertszeit ca. 2 h nach Injektion, einige Minuten nach oraler Applikation) Clorazepat wird nach oraler Applikation rasch und weitgehend resorbiert (Bioverfügbarkeit ca. 91 %); die Metabolisierung wird durch Decarboxylierung zum Nordiazepam eingeleitet und findet offenbar z.T. schon unter den im Magen herrschenden, sauren Bedingungen statt. Hauptsächlich erfolgt die Umwandlung zu diesem Primärmetaboliten in der Leber und setzt ebenfalls schnell ein (First-Pass-Metabolismus bei oraler Applikation: Der Wirkstoff durchläuft nach Resorption aus dem Verdauungstrakt die Leber und wird dort schon beim ersten Durchlauf weitgehend metabolisiert), wobei die maximale Plasmakonzentration des Metaboliten Nordiazepam bei oraler Applikation nach ca. 1 h, bei parenteraler Applikation nach ca. 12 h (ca. 2800-3600 ng/ml nach 50-mg-Injektion) erreicht wird. Anschließend erfolgt Hydroxylierung zum Oxazepam und nach Glucuronidierung Elimination über den Urin. Als Nebenmetaboliten sind auch das Nordiazepam und Konjugate des p-Hydroxy-nordiazepams feststellbar. Die Eliminationshalbwertszeit des Primärmetaboliten Nordiazepam wird mit 40 h angegeben. In Studien mit radioaktiven Tracern konnte der Konsum von 15 mg Clorazepat noch nach 10 Tagen im Urin nachgewiesen werden, wobei allerdings 85 % der applizierten Dosis bereits aus dem Körper eliminiert waren. Aufgrund der langen Halbwertszeit kann durch regelmäßige Applikation schnell ein Wirkstoffspiegel aufgebaut werden. Die Tendenz zur Einlagerung in das Fettgewebe ist für den Ausgangswirkstoff und auch für die Metaboliten aufgrund der relativ geringen Lipophilie im Vergleich zu den N-alkylierten Derivaten eher wenig ausgeprägt. 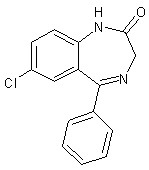 Nordiazepam Nordiazepam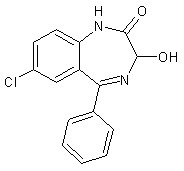 Oxazepam OxazepamDas Oxazepam schließlich kann glucuronidiert und über die Nieren ausgeschieden werden. Wirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Schneller Wirkeintritt bei einer Wirkdauer, die bis zum nächsten Tag reichen kann. Symptome: Seh- und Sprachstörungen (Diplopie, Dysarthrie) sowie Gleichgewichts- und Bewegungsstörungen (Ataxie). Unregelmäßigkeiten bei der Atmung, Atemaussetzer bishin zur Atemlähmung. Benommenheit/Verwirrtheit, Schläfrigkeit, starke Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens, Kopfschmerzen, langsamer Puls, Koordinationsstörungen, Schwindel. Rauschartige Empfindungen können eintreten. Mundtrockenheit, Magen-Darm-Beschwerden, Paradoxe Reaktionen wie Reizbarkeit, erhöhte Aggressivität und Aufregung wurden beobachtet. Wirkungsweise: Neben den muskelrelaxierenden und krampflösenden Effekten wirkt die Einnahme von Clorazepat wegen der Metaboliten (Nordiazepam!) dämpfend auf das Zentralnervensystem. Hieraus resultieren neben den oben beschriebenen körperlichen Symptomen auch eine Verringerung der Denkleistung, Gedächtnisstörungen (insbesondere für den Zeitraum unmittelbar vor und nach der Applikation (anterograde Amnesie)) sowie Störung der kognitiven und psychomotorische Fähigkeiten. Niedriger Blutdruck, Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit und Koma können dosisabhängig eintreten. Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich. Bei Mischkonsum mit Alkohol und vielen anderen Wirkstoffen werden die Clorazepat -Wirkungen verstärkt. Akute Toxizität: Überdosierung kann zu Koma und Atemdepression führen. LD50(oral, Ratte) = 880 mg/kg (--> „gesundheitsschädlich“ nach Stoffrecht) LD50(intravenös, Ratte) = 279 mg/kg Studien zur Teratogenität von Clorazepat liegen nicht in ausreichendem Maße vor; die strukturelle Ähnlichkeit und insbesondere der in weiten Teilen mit Diazepam zusammenfallende Metabolismus lässt vermuten, dass Clorazepat fruchtschädigend wirkt und zu Missbildungen bei ungeborenen Kindern führen kann, insbesondere bei Einnahme während der ersten drei Schwangerschaftsmonate. Ergebnisse zu allgemeinen Entwicklungsstörungen (vermindertes Gewicht, niedriger Blutdruck, etc.) sind offenbar vorhanden. Akkumulation der pharmakologisch wirksamen Metaboliten in der Muttermilch ist wahrscheinlich. Chronische Toxizität: Leberschäden. Sehr ernste Gefahr psychischer und physischer Abhängigkeit, auch bei medizinischer, kurzzeitiger Anwendung. Plötzliche Absetzung nach chronischem Konsum führt zu schweren Entzugserscheinungen; aus diesem Grunde muß Clorazepat „ausgeschlichen“ werden, d.h. die Dosis muß unter ärztlicher Kontrolle langsam bis auf Null reduziert werden. Entzugserscheinungen: Neben den klassischen Entzugserscheinungen sind Rebound-Effekte möglich. Entzugserscheinungen beginnen beginnen je nach Konsummuster nach einigen Stunden bis zu einer Woche nach Konsumstopp. Sie äußern sich in Schweißausbrüchen, Kopfschmerzen, Muskelzittern (Tremor) und Muskelkrämpfe, Schlaflosigkeit, Übelkeit und Erbrechen und Diarrhoe. Nervosität, Schlaflosigkeit, Verwirrtheit, Gedächtnisstörungen und Wahrnehmungsstörungen sowie Angstzustände sind möglich. Schwere Entzugserscheinungen können zu Anfällen und Delirien führen. Aufgrund der schweren Entzugserscheinungen darf Diazepam-Applikation nicht schlagartig abgesetzt werden, sondern die Applikation muß unter ärztlicher Aufsicht ggf. über mehrere Wochen vorsichtig bis auf Null reduziert werden („ausschleichen“). -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 22.11.2007, 20:44 22.11.2007, 20:44
Beitrag
#26
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Nordiazepam
CAS-Nr.: 1088-11-5 Synonyme: 7-Chlor-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on Nordazepam, N-Desmethyldiazepam Stilny, Vegesan, Calmday, Madar, Nordaz, Praxadium, Tranxilium N Chemische Gruppe: Benzodiazepine Strukturformel und Stäbchenmodell: 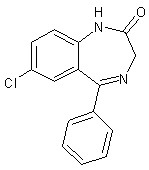 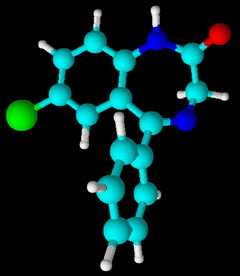 Vorkommen/Verwendung: Nordiazepam ist eine zentrale, relativ persistente Zwischenstufe bei der Metabolisierung einer Vielzahl von Benzodiazepinen. Der Stoff ist selbst pharmakologisch hochwirksam und viele Benzodiazepin-Präparate zielen darauf ab, ihn im Rahmen der Metabolisierung freizusetzen. Darüber hinaus wird Nordiazepam auch als eigenständiger Wirkstoff in Medikamenten verwendet. Das Einsatzgebiet entspricht dem der anderen Benzodiazepine: Beruhigungs- bzw. Schlafmittel, Behandlung von akuten Erregungs- und Angstzuständen, Muskelrelaxans, Sedativum und Antikonvulsivum. Aufnahme: Medizinischer Einsatz in oraler Form. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für Benzodiazapine: 100-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Blut-/Serumanalytik: 15-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Urin: 50 ng/ml Nachweiszeit im Urin: 3 Tage bei therapeutischer Dosis, bis zu 4-6 Wochen bei Langzeiteinnahme Haaranalyse empfindlich gegen Bleichen; Analysen im pg/mg-Bereich; Routine-Haaranalyse Cut-Off = 0,05 ng/mg. Schnelltests gestört durch: ß-Blocker Neuroleptika Bewertung: Nordiazepam ist Bestandteil der Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: Nordiazepam wird mit einer Halbwertszeit von 40-50 h (mitunter wird eine Streubreite von 30-150 h angegeben) in der Leer zu Oxazepam metabolisiert. 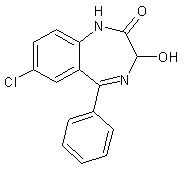 Oxazepam OxazepamDas Oxazepam wird glucuronidiert und im Wesentlichen renal ausgeschieden. Wirkungen: Die frei verfügbare Internet-Literatur zu den Symptomen, Wirkungen, Nebenwirkungen und Entzugserscheinungen des Nordiazepam-Konsums ist eher übersichtlich. Nordiazepam ist aber ein maßgeblich pharmakologisch wirksamer Metabolit von Diazepam und Clorazepat, sodaß dieser Stoff in bedeutendem Maße zu den dort beschriebenen Wirkungen beitragen wird. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 26.11.2007, 19:16 26.11.2007, 19:16
Beitrag
#27
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Oxazepam
CAS-Nr.: 604-75-1 Synonyme: 7-Chlor-3-hydroxy-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on Adumbran, Anxiolit, Azutranquil, Praxiten (z.T.), Oxahexal, Durazepam, Noctazepam, Ovaribran; einige der genannten Medikamente sind Multi-Wirkstoff-Präparate, die Oxazepam enthalten. Chemische Gruppe: Benzodiazepine Strukturformel und Stäbchenmodell: 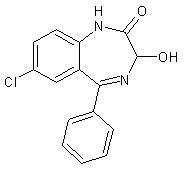 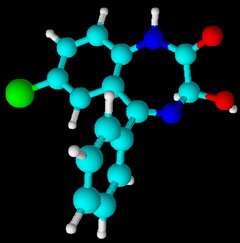 Vorkommen/Verwendung: Farbloser oder gelblicher Feststoff. Medizinische Verwendung als Psychopharmakon mit kurzer bis mittellanger Wirkdauer. Wirkeintritt ist langsamer als bei anderen Benzodiazepinen, sodaß Oxazepin für die Behandlung in akuten Situationen weniger geeignet ist. Weitere Verwendung als Beruhigungs- bzw. Schlafmittel sowie zur Behandlung von akuten Erregungs- und Angstzuständen, neurovegetativen und psychosomatischen Störungen. Einsatz als Muskelrelaxans, Sedativum und Antikonvulsivum. Aufnahme: Medizinischer Einsatz in oraler Form. Einzeldosen von 5-15 mg bei einer Tagesdosis von maximal 30 mg bei ambulanter Behandlung, höhere Dosierung bei stationärer Überwachung möglich. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für Benzodiazapine: 100-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Blut-/Serumanalytik: 15-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Urin: 50 ng/ml Nachweiszeit im Urin: 3 Tage bei therapeutischer Dosis. Haaranalyse empfindlich gegen Bleichen Analysen im pg/mg-Bereich; Routine-Haaranalyse Cut-Off = 0,05 ng/mg. Schnelltests gestört durch: ß-Blocker Neuroleptika Bewertung: Oxazepam ist Bestandteil der Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: Oxazepam wird nach oraler Applikation weitgehend resorbiert (Bioverfügbarkeit ca. 85 %); die Absorptionshalbwertszeit beträgt ca. 30 Minuten. Ein konstanter Plasmaspiegel wird nach etwa 2 Tagen Applikation erreicht. Die Metabolisierung erfolgt einstufig zum pharmakologisch inaktiven Glucuronsäure-Konjugat, welches über den Urin ausgeschieden wird. Die mittlere Eliminationshalbwertszeit ist weitgehend unabhängig vom Probanden-Alter sowie der Leberfunktion und beträgt im Mittel 8 h. Unerwünschte Kumulation bei regelmäßigem Konsum wird nicht beobachtet. Wirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkdauer: 8-12 h. Wirkeintritt bei Injektion nahezu unmittelbar. Symptome: Seh- und Sprachstörungen (Diplopie, Dysarthrie), Muskelschwäche sowie Gleichgewichts- und Bewegungsstörungen (Ataxie). Unregelmäßigkeiten bei der Atmung, Atemaussetzer (bsp. Schlaf-Apnoe) bishin zur Atemlähmung. Benommenheit/Verwirrtheit, Schläfrigkeit, starke Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens, Kopfschmerzen, langsamer Puls, niedriger Blutdruck, erniedrigte Körpertemperatur, Koordinationsstörungen. Mundtrockenheit, Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe). Störung der motorischen Koordination. In manchen Fällen treten paradoxe Reaktionen auf, wie z.B. Aufregung, beschleunigter Herzschlag und gesteigerte Aggressivität sowie Halluzinationen und Angstzustände, insbesondere bei älteren Menschen. Wirkungsweise: Oxazepam wirkt sedierend, schlafanstossend, angstlösend, beruhigend und antikonvulsiv. Aus der dämpfenden Wirkung auf das Zentralnervensystem resultieren neben den oben beschriebenen körperlichen Symptomen auch eine Verringerung der Denkleistung, Gedächtnisstörungen (insbesondere für den Zeitraum unmittelbar vor und nach der Applikation (anterograde Amnesie)) sowie Störung der kognitiven und psychomotorische Fähigkeiten. Das gesamte Herz-Kreislauf-System wird durch Oxazepam beeinflusst; Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit und Koma können dosisabhängig eintreten. Menstruationsstörungen und Störungen der Libido. Überempfindlichkeitsreaktionen sind in seltenen Fällen möglich. Bei Mischkonsum mit Alkohol und vielen anderen Wirkstoffen werden die Oxazepam-Wirkungen verstärkt. Akute Toxizität: Überdosierung kann zu Koma und Lungenversagen führen, wenngleich Todesfälle aufgrund Oxazepam-Vergiftungen eher selten berichtet werden. Demgegenüber stehen allerdings viele tödliche Mischintoxikationen unter Beteiligung von Oxazepam. Bei parenteraler Applikation können Gewebereizungen und Thrombophlebitis auftreten. Es gibt Hinweise auf eine fruchtschädigende Wirkung von Oxazepam, insbesondere bei Einnahme während der ersten drei Schwangerschaftsmonate. Die Applikation von Oxazepam während der Spätphase der Schwangerschaft oder während der Geburt kann beim Neugeborenen zu Hypotonie, Hypothermie, Hypoaktivität und Atemdepression führen. Oxazepam akkumuliert ferner in der Muttermilch. Chronische Toxizität: Muskelerschlaffung. Sehr ernste Gefahr psychischer und physischer Abhängigkeit, auch bei medizinischer, kurzzeitiger Anwendung. Plötzliche Absetzung nach chronischem Konsum führt zu schweren Entzugserscheinungen; aus diesem Grunde muß Diazepam „ausgeschlichen“ werden, d.h. die Dosis muß unter ärztlicher Kontrolle langsam bis auf Null reduziert werden. Entzugserscheinungen: Entzugserscheinungen beginnen manchmal ein paar Stunden nach der Applikation, in anderen Fällen erst nach einer Woche oder noch längerer Abstinenz. Sie äußern sich in Kopfschmerzen, Muskelzittern (Tremor), Schlaflosigkeit und Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Wahrnehmungsstörungen. Mitunter Schweißausbrüche, Muskel- und Bauchkrämpfe; in schweren Fällen Delirien und zerebrale Krampfanfälle. Aufgrund der schweren Entzugserscheinungen darf Oxazepam-Applikation nicht schlagartig abgesetzt werden, sondern die Applikation muß unter ärztlicher Aufsicht ggf. über mehrere Wochen vorsichtig bis auf Null reduziert werden („ausschleichen“). -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
 07.12.2007, 22:15 07.12.2007, 22:15
Beitrag
#28
|
|
 Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Flunitrazepam
CAS-Nr.: 1622-62-4 EG-Nr.: 216-597-8 RTECS-Nr.: DF2385000 Synonyme: 5-(2-Fluorphenyl)-1-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on Ro-5-4200 Rohypnol, Darkene; Flunipam; Hypnocalm, Hypnodorm, Valsera, Narcozep, Somnubene, Somnibel, Noriel, Flunipam Ruppy, Roiperl, Rippen, Ruffy, R2, Ro Chy, Ropy, Fluny, Ropse Chemische Gruppe: Benzodiazepine Strukturformel und Stäbchenmodell: 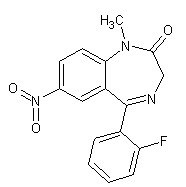 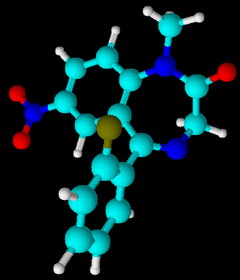 Vorkommen/Verwendung: Farbloser oder gelblicher Feststoff; in medizinischen Präparaten mitunter eingefärbt. Medizinische Verwendung als hochwirksames Hypnotikum und Beruhigungs- bzw. Schlafmittel sowie Muskelrelaxans, Sedativum, Antikonvulsivum und Anxiolyticum, z.B. für präoperative Zwecke (chirurgische Eingriffe, invasive Diagnostik, Zahnbehandlungen). Missbrauch im Allgemeinen bei psychischen Belastungen oder Störungen und zur kurzfristigen Überbrückung unangenehmer Situationen, aber auch aus Rauschmotiven: Bereits 4 mg Flunitrazepam können euphorisierende Effekte hervorrufen. Wegen seiner hohen Potenz missbräuchliche Verwendung bei Opiat-Abhängigen, hier auch oft während einer Substitutions-Therapie. Einerseits sollen Entzugserscheinungen gedämpft werden (z.B. bei Versorgungsengpässen oder bei zu niedriger Substitutionsdosis), andererseits Opiatabhängige in besonderem Maße psychischen Belastungen, die durch den Wirkstoff überdeckt werden sollen. Ein weiterer Zweck ist eine anfängliche Sedierung vor der Einnahme einer zweiten Droge, um durch durch den stimulierenden Effekt des zweiten Wirkstoffs einen besonders steilen Wirkungsgradienten zu erzeugen, um den Kick zu erhöhen. Aufnahme: Medizinischer Einsatz in oraler Form als Pillen oder Pulver sowie als Injektion. Als Prämedikation bei einer Narkose sowie zur Narkose-Einleitung werden 1-2 mg intramuskulär injiziert; bei intravenöser Applikation reduziert sich die Dosis auf 0,5 mg. Zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen in oraler Form bei einer Tagesdosis von 0,5-1 mg, ggf. bis 2 mg. Die medizinsche Behandlungsdauer sollte wegen der beträchtlichen negativen Nebenwirkungen nicht länger als 4 Wochen betragen, wobei die letzten zwei Wochen schon zur „Ausschleichung“ (s.u.) verwendet werden sollen. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für Benzodiazapine: 100-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Blut-/Serumanalytik: 15-300 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Urin: 50 ng/ml Nachweiszeit im Urin: 3 Tage bei therapeutischer Dosis, bis zu 4-6 Wochen bei Langzeiteinnahme Haaranalyse empfindlich gegen Bleichen Analysen im pg/mg-Bereich Schnelltests gestört durch: ß-Blocker Neuroleptika Bewertung: Flunitrazepam ist Bestandteil der Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel). Ein Bewerber um die Fahrerlaubnis erfüllt nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt ( §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.1), sofern der Wirkstoff nicht zur bestimmungsgemäßen Behandlung eines konkreten Krankheitsfalles verschrieben wurde, oder von ihnen abhängig ist (§11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.3). Gem. §11 FeV, Abs. 2 und §14 FeV, Abs. 1, Punkt 2 kann die FEB bei Eignungszweifeln ein ärztliches Gutachten und ggf. auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Steht mangelnde Eignung fest, ist ein Gutachten nicht notwendig. Ein Bezug zur Teilnahme am Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist gem. §14 FeV, Abs. 2 zur Klärung von Eignungszweifeln anzuordnen, wenn die Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums entzogen war bzw. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder - ohne abhängig zu sein - weiterhin Drogen einnimmt. Metabolisierung: Flunitrazepam wird nach oraler Applikation nahezu vollständig resorbiert (Bioverfügbarkeit ca. 70-90 %). Bei oraler Applikation werden ca. 10-15 % über einen First-Pass-Mechanismus in der Leber metabolisiert. Die maximale Plasmakonzentration wird durchschnittlich innerhalb von 0,75-2 Stunden erreicht, und beträgt nach einer Einmaldosis von 1 mg etwa 6-11 ng/ml. Im Bereich von 0,5-4 mg verhält sich die Pharmakokinetik von Flunitrazepam linear. Der therapeutische Blutspiegel liegt bei etwa 6 ng/ml; intensive narkotisierende Wirkung tritt bei 12-15 ng/ml ein. Flunitrazepam ist relativ gut fettlöslich; dies, in Zusammenhang mit den langen Halbwertszeiten der Metaboliten, kann bei mehrfacher Applikation zu einer Kumulation führen und die Nachweiszeiten für Benzodiazepin-Konsum verlängern. Bei subchronischer und chronischer Applikation therapeutischer Dosen wird das dynamische Gleichgewicht nach ca. 5 Tagen erreicht, wobei der Plasmaspiegel um den Faktor 1,6-1,7 über den Werten nach einer Einmal-Dosis liegen. Unter diesen Bedingungen bewegen sich die Konzentrationen des pharmakologisch wirksamen N-Desmethyl-Metaboliten auf ähnlichem Niveau, wobei die Wirkschwelle für den Metaboliten allerdings unterschritten ist. Die Metabolisierung erfolgt primär in der Leber und besteht einerseits aus der typischen N-Demethylierung oder Hydroxylierung in 3-Stellung, andererseits aber aus der Reduktion der Nitro-Gruppe zum Amin und teilweiser Acetylierung der Amino-Gruppe. Die Reaktionsfolge ist dabei variabel, sodaß entsprechend der Metabolisierungsrouten die unterschiedlichen Metaboliten gebildet werden; als Hauptmetaboliten werden dabei das 7-Amino-flunitrazepam und das N-Desmethylflunitrazepam registriert. Die schließlich resultierenden 3-Hydroxy- und 7-Amino-Verbindungen können glucuronidiert und über den Urin ausgeschieden werden. Hauptsächlich wird im Urin das 7-Amino-flunitrazepam nachgewiesen; die Anteile an unverändert ausgeschiedenem Wirkstoff und an Desmethyl-flunitrazepam betragen weniger als 2 % der ursprünglichen Dosis. Flunitrazepam hat eine altersunabhängige Halbwertszeit von ca. 10-30 h., die Eliminationshalbwertzeit von 7-Aminoflunitrazepam beträgt 10–16 Stunden, diejenige von N-Desmethylflunitrazepam 28 Stunden. Wirkungen: Wirkungseintritt und -dauer: Wirkeintritt bei oraler Applikation nach ca. 15-20 min. für eine Wirkdauer von 4-8 h; einige Auswirkungen der Flunitrazepam-Applikation können bis zu 12 h andauern. Symptome: Sehstörungen (Diplopie) und Bewegungsstörungen (Ataxie). Unregelmäßigkeiten bei der Atmung, Atemaussetzer bishin zur lebensbedrohlichen Atemdepression können auftreten, insbesondere bei Konsum weiterer atemdepressiv wirkender Stoffe. Benommenheit/Verwirrtheit, Schläfrigkeit, Mattigkeit und Muskelschlaffheit, starke Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, langsamer Puls, Blutdruckabfall, Koordinationsstörungen, Krampfanfälle. Mundtrockenheit, Magen-Darm-Beschwerden. Besonders bei Kindern oder älteren Menschen kann es verstärkt zu paradoxen Reaktionen kommen, verbunden mit akuten Erregungs- und Angstzuständen, gesteigerter Aggressivität, Muskelkrämpfen, Ein- und Durchschlafstörungen, Alpträumen, Halluzinationen, Depressionen und suizidalen Ambitionen. Wirkungsweise: Flunitrazepam ist ein hochwirksames Benzodiazepin: Der sedative Effekt ist etwa 7-10mal stärker als beim Diazepam. Ursache für die hohe Potenz ist u.a. die sterische Fixierung des Phenylsubstituenten durch die Fluorierung in ortho-Stellung, wodurch die Affinität zum GABA-Rezeptor, dem hauptsächlichen Angriffspunkt der Benzodiazepine, erhöht wird. Flunitrazepam wirkt dämpfend auf das Zentralnervensystem. Hieraus resultieren neben den oben beschriebenen körperlichen Syptomen auch eine Verringerung der Denkleistung und Gedächtnisstörungen, insbesondere für den Zeitraum unmittelbar vor und nach der Applikation (anterograde Amnesie). Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit und Koma können dosisabhängig leicht eintreten. Bei medizinischer Anwendung wird von Alpträumen berichtet, Überempfindlichkeitsreaktionen und Sexualschwäche sind möglich. Toleranzen gegen die medizinisch erwünschten Wirkungen können bei Selbstmedikation zu gefährlichen Dosissteigerungen führen und erhöhen das Suchtpotenzial. Überdosierung kann rauschähnliche Zustände herrufen. Studien belegen euphorisierende Zustaände ab einer Dosis von 4 mg Flunitrazepam. Bei Mischkonsum mit Alkohol werden die Auswirkungen von Flunitrazepam verstärkt, und es kann noch 10 h nach der Applikation zu starker Beeinträchtigung von Bewegungsabläufen und trainierten Verhaltensweisen (z.B. im Straßenverkehr) kommen. Mischkonsum insbesondere mit anderen zentral wirkenden Psychopharmaka, Muskelrelaxantien, Hypnotika und Anästhetika kann zu einer wechselseitigen Verstärkung der Wirkungen führen. Rohypnol wird gerne von Opiat-Abhängigen in Form von Beikonsum missbraucht, auch während bsp. Einer Methadon-Substitution. Insbesondere bei Methadon-assoziierten Todesfällen konnte signifikant häufig Benzodiazepin-Beikonsum festgestellt werden. In Form von Rebound-Effekten kann es nach Absetzen der medizinischen Applikation für einigen Zeit zu Schlafstörungen, Unruhe und Stimmungsschwankungen kommen. Akute Toxizität: LD50(oral, Ratte) = 450 mg/kg ( „gesundheitsschädlich“ nach Stoffrecht) Es gibt klare Hinweise für eine fruchtschädigende Wirkung von Flunitrazepam. Flunitrazepam akkumuliert ferner in der Muttermilch. Chronische Toxizität: Gefahr von Leberschäden. Schlafstörungen, psychoseartige Zustände wie Verfolgungswahn, erhöhte Reizbarkeit. Sehr ernste Gefahr psychischer und physischer Abhängigkeit, auch bei medizinischer, kurzzeitiger Anwendung. Plötzliche Absetzung nach chronischem Konsum führt zu schweren Entzugserscheinungen; aus diesem Grunde muß Flunitrazepam „ausgeschlichen“ werden, d.h. die Dosis muß unter ärztlicher Kontrolle langsam bis auf Null reduziert werden (üblicherweise über zwei Wochen). Gegenüber den Wirkungen von Flunitrazepam können sich Toleranzen entwickeln, die bei Missbrauch zu Dosissteigerungen führen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Entzugserscheinungen: Entzugserscheinungen beginnen zuerst langsam mit dem Konsumstopp, werden aber nach ca. 1 Woche zunehmend ernster. Sie äußern sich in Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Muskelzittern (Tremor), Schweißausbrüchen, Ruhelosigkeit/Schlaflosigkeit sowie Muskel- und Bauchkrämpfen. Angstzustände, Psychosen und Halluzinationen sind möglich. Schwere Entzugserscheinungen können zu zerebralen Anfällen und Delirien führen. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |
|
|
|
  |
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1 | Anonyme Besucher: 0)
0 Mitglieder:

|
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 23.11.2024 - 22:59 |